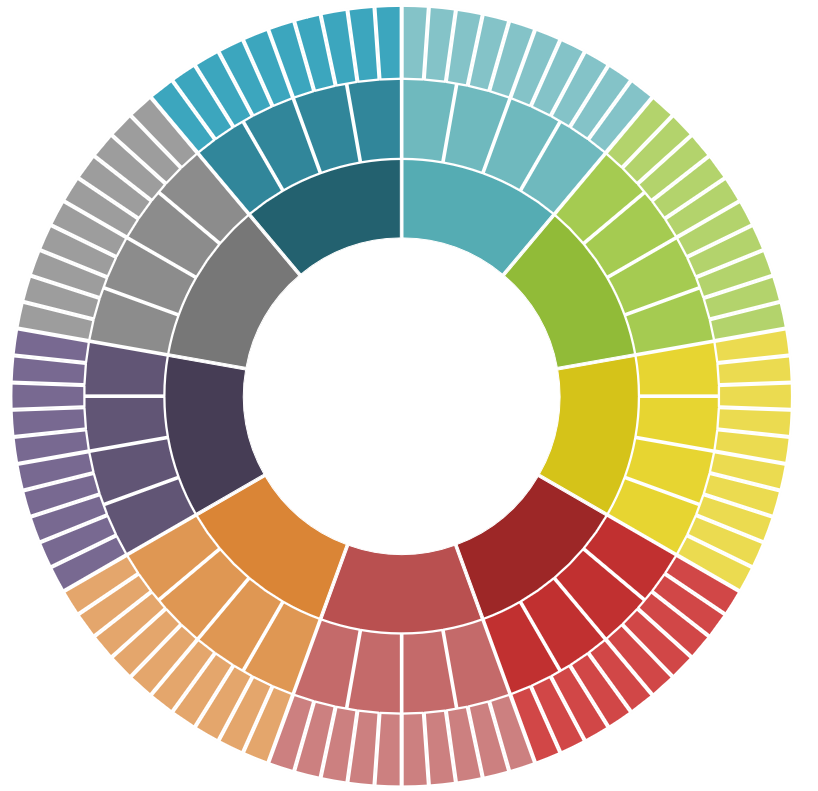Volltextsuche nutzen
- versandkostenfrei ab € 30,–
- 6x in Wien und Salzburg
- 6 Mio. Bücher
- facultas
- Detailansicht
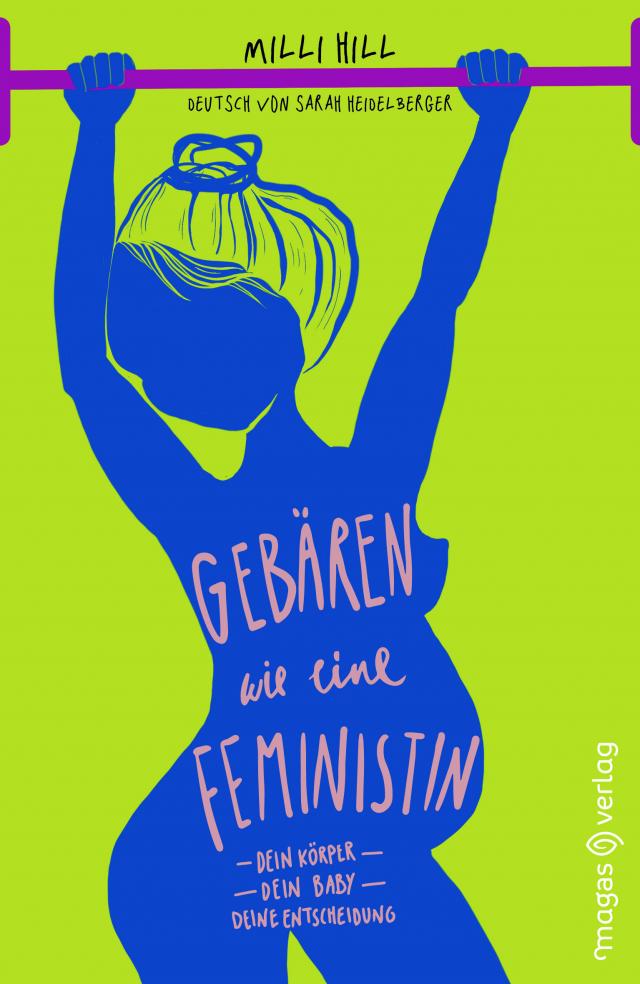
Gebären wie eine Feministin
Dein Körper. Dein Baby. Deine Entscheidung.
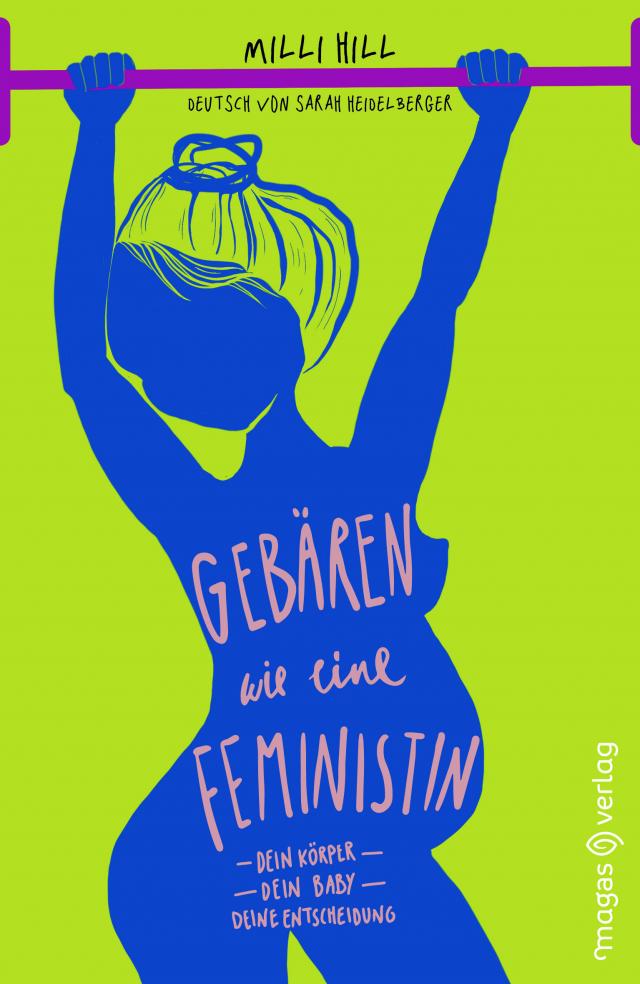
Taschenbuch
22,70€
inkl. gesetzl. MwSt.
Besorgungstitel
Lieferzeit 1-2 WochenVersandkostenfrei ab 30,00 € österreichweit
Lieferzeit 1-2 WochenVersandkostenfrei ab 30,00 € österreichweit
unter € 30,00 österreichweit: € 4,90
Deutschland: € 10,00
EU & Schweiz: € 20,00
Deutschland: € 10,00
EU & Schweiz: € 20,00
In den Warenkorb
Click & Collect
Artikel online bestellen und in der Filiale abholen.
Derzeit in keiner facultas Filiale lagernd. Jetzt online bestellen!Artikel online bestellen und in der Filiale abholen.
Artikel in den Warenkorb legen, zur Kassa gehen und Wunschfiliale auswählen. Lieferung abholen und bequem vor Ort bezahlen.
Auf die Merkliste
Veröffentlicht 2022, von Milli Hill bei Magas Verlag, HarperCollinsPublishers Ltd
ISBN: 978-3-949537-07-3
Auflage: 1. Auflage
336 Seiten
20 cm x 13 cm
Wir alle bilden uns gern ein, dass wir freie Entscheidungen treffen, aber wir alle sind ein Produkt unserer Kultur, der Geschichten, die wir gehört, der Werbungen und Fernsehserien, die wir gesehen und der Erwartungen, die wir auf dieser Grundlage bezüglich der verschiedensten Ereignisse entwickelt haben. Gebärt man beispielsweise im Bett auf dem Rücken liegend, mag sich das nach freier ...
Beschreibung
Wir alle bilden uns gern ein, dass wir freie Entscheidungen treffen, aber wir alle sind ein Produkt unserer Kultur, der Geschichten, die wir gehört, der Werbungen und Fernsehserien, die wir gesehen und der Erwartungen, die wir auf dieser Grundlage bezüglich der verschiedensten Ereignisse entwickelt haben. Gebärt man beispielsweise im Bett auf dem Rücken liegend, mag sich das nach freier Entscheidung anfühlen – aber dieser Entscheidung liegt eine Myriade an Einflüssen zugrunde, von Fernseh-Dokus, in denen typische Krankenhausgeburten gezeigt werden, bis hin zu der Tatsache, dass im Zentrum der meisten Geburtsräume ein riesiges Bett steht. All diese Einflüsse haben womöglich dazu geführt, dass man denkt, so würden „Geburten eben ablaufen“. Der Feminismus muss tiefer graben. Er muss Entscheidungen rund um Geburten und die Erfahrungen, die Frauen beim Gebären machen, im Licht der Menschenrechte neu bewerten und dadurch eine Welt erschaffen, in der gebärende Frauen eine deutlich größere Bandbreite an Entscheidungen treffen können.
Einführung oder Vorwort
Während ich dieses Buch geschrieben habe, gab es immer wieder Augenblicke, in denen ich mich fragte: Wieso eigentlich ich? Da war sie mal wieder, diese kritische kleine Stimme in mir. (Und versucht bloß nicht, mir einzureden, ihr wüsstet nicht genau, wovon ich rede!) Sie sagte: »Milli, bist du wirklich sicher, dass du auch noch diese Büchse der Pandora öffnen willst? Hat es dir ehrlich nicht gereicht, einen Diskurs über Geburten anzustoßen? Und jetzt kommst du auch noch mit der Tretmine Feminismus daher? Sag mal, spinnst du eigentlich? Man wird dich teeren und federn – na ja, zumindest bildlich gesprochen.« Ich sollte vielleicht anmerken, dass die kritische kleine Stimme in mir einen eher fragwürdigen Humor hat.
Aber sie hat schon recht: Es ist nicht leicht, über Geburten zu sprechen und noch viel weniger, feministische Themen anzuschneiden. Das geht oft ja schon bei der Frage los, was Feminismus überhaupt ist. Wobei ich selbst in dieser Hinsicht einen ziemlich simplen Ansatz fahre: Feminismus bedeutet, es zu erkennen, wenn Frauen ungerecht behandelt werden, und etwas dagegen zu tun. Und genau da liegt das Problem, wenn es um Geburten geht: Viel zu wenige Menschen bemerken überhaupt, dass Frauen in diesem Zusammenhang ungerecht behandelt werden, und noch viel weniger tun etwas dagegen. Wir sind blind für das massive Machtgefälle im Geburtsraum und haben aus ungeklärten Gründen einfach akzeptiert, dass Geburten nun einmal eine unangenehme und ziemlich würdelose Angelegenheit sind – wenn nicht sogar übergriffig, traumatisierend und erniedrigend. »Tja, so ist das eben!«, heißt es dann. Deswegen schreibe ich dieses Buch: Um euch zu sagen, dass es auch anders laufen kann. Und dass wir als Feministinnen diesen Status quo nicht länger hinzunehmen brauchen.
Feminismus muss nicht kompliziert sein, und er braucht auch nicht exkludierend zu sein. Zu gebären wie eine Feministin, muss nicht bedeuten, dass man auf eine ganz bestimmte Art und Weise gebiert, ebenso wenig wie das Prädikat »feministisch« in irgendeinem anderen Lebensbereich – sei es im Beruf, in der Beziehung oder bei der Kindererziehung – bedeutet, dass nur eine einzige Handlungsoption die richtige ist. Du kannst in jeder Umgebung und auf jede Weise feministisch gebären – von der geplanten Sectio in einem Privatkrankenhaus bis hin zur freien Geburt im Meer. Du brauchst nur eins zu tun: die passive Einstellung abzuschütteln, dass Geburten etwas sind, das dir passiert und das sich deiner Kontrolle entzieht, und zu erkennen, dass du ziemlich schlecht dabei wegkommen könntest, wenn du nicht aufwachst und das Ruder in die Hand nimmst. Kurz gesagt: Übernimm die Verantwortung und die Kontrolle und triff bewusste Entscheidungen.
Wenn ich auf Mainstream-Events rund um das Thema Geburten Vorträge halte, schockiert es mich immer wieder aufs Neue, dass viele Frauen und ihre Partner:innen es als Offenbarung verstehen, wenn man ihnen mitteilt, dass sie im Geburtsraum Rechte haben und selbstbestimmt entscheiden können. Viele Menschen erleben sich während Wehen und Geburt nicht als selbstbestimmte, starke Individuen und haben auch nicht den Eindruck, Einfluss auf den Ablauf der Geburt nehmen zu können. Häufig sind sie falsch informiert, zum Teil auch, weil sie von vornherein mit der Überzeugung in die Schwangerschaft hineingehen, sie hätten kaum oder nur wenige Handlungsmöglichkeiten, weswegen sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sich tiefergehend zu informieren. Was soll es in einem Umfeld, in dem mit beunruhigender Häufigkeit der Ausdruck »nicht erlaubt« zum Einsatz kommt, schon bringen, sich über seine Möglichkeiten zu informieren? Die meisten Paare, die ein Kind erwarten, glauben, dass die Mehrheit der Entscheidungen nicht in ihren Händen liegt.
In der Praxis bedeutet das, dass tagtäglich Frauen, die nicht wissen, dass sie den Eingriff verweigern können, Finger in die Vagina geschoben werden. Wie kann es sein, dass wir das stillschweigend akzeptieren? Selbst in den fortschrittlichsten Diskussionen um das Thema Geburt wird der Ausdruck »informierte Einwilligung« genutzt, der unausgesprochen voraussetzt, dass das Ziel in der Einwilligung besteht, nicht etwa in einem Entscheidungsprozess oder sogar einer informierten Weigerung. Eine Fachkraft in der Geburtshilfe sagt beispielsweise, dass sie »kurz die Einwilligung einholen geht«, als wäre sie die aktive Person in diesem Austausch und die Frau passiv. Es ist an der Zeit, das System infrage zu stellen, das diesen Mythos der bedingungslosen Kooperation und Machtlosigkeit der Frau aufrechterhält.
Erhebt man Beschwerde über Erfahrungen, die typischerweise nur Frauen machen, wird man häufig direkt darauf aufmerksam gemacht, wie selten und »nischig« das Problem doch sei und wie gut es die meisten Frauen doch hätten. Diese Taktik der thematischen Verschiebung wird durch das Hashtag #NotAllMen wunderbar versinnbildlicht. Frauen sollen damit daran erinnert werden, wie viele gute, ausgeglichene Männer da draußen herumlaufen, sobald sie irgendein Problem auf den Tisch bringen, sei es Mansplaining oder Vergewaltigung. »#NotAllMen sind Vergewaltiger. #NotAllMen sind sexistisch. Nicht vergessen, #NotAllMen schlagen ihre Frauen.« Aber Moment mal, sagen dann die Frauen, uns geht es doch auch gar nicht um den großen Prozentsatz wunderbarer Männer, die respektvoll mit Frauen umgehen. Uns geht es um die anderen, die es nicht tun. Aber durch das Ablenkungsmanöver wurde der eigentliche Punkt bereits verwässert, wodurch der Aggressor auf einmal in die Opferrolle versetzt wird.
Ebendieses Manöver wird auch im Diskurs über Geburten angewendet. Thematisiert man gegenüber Angestellten des Gesundheitswesens Probleme wie medizinische Eingriffe, denen nicht zugestimmt wurde; institutionalisierte Frauenfeindlichkeit; dass Frauen in den Wehen nicht richtig zugehört wird oder auch Rassismus in der Geburtshilfe, bekommt man häufig Reaktionen zu hören wie: »Wo ich arbeite, ist das nicht so«, »Nicht alle Hebammen sind so«, »Es sollten nicht alle über einen Kamm geschert werden«.
Bevor wir uns also auf die Reise durch dieses Buch begeben, möchte ich betonen, dass ich mich hier nicht auf individuelle Personen konzentrieren möchte, sondern auf die Systeme, in denen sie handeln. Die Geburtshilfe ist ein System, das infrage gestellt werden muss, ebenso wie das System, auf dem es aufbaut und in das es ein10
Einführung
gebettet ist – das Patriarchat. Bitte lenke nicht von diesem wichtigen Thema ab, nur weil du selbst eine Arbeitsweise an den Tag legst, die Frauen als selbstbestimmte Wesen respektiert, oder weil du während deiner eigenen Schwangerschaft eine wunderbare Betreuung erfahren hast. Beides ist toll – aber es ist nicht das Thema dieses Buches.
Ähnlich wird manchmal dazu aufgerufen, dass mehr über die wunderbaren Männer – oder eben die wunderbaren Geburtshelferinnen und -helfer – gesprochen werden sollte, die »es richtig machen«. Und natürlich, ja: Da draußen gibt es eine Menge hervorragender Hebammen, Ärztinnen und Ärzte, Geburtsstationen und Organisationen, die eine fantastische, auf die jeweilige Frau zentrierte Geburtshilfe leisten. Und ja: Lob ist etwas Wunderbares. Und ja: Ein paar von ihnen tauchen in diesem Buch auf. Aber müssen wir wirklich wieder und wieder betonen, wie fantastisch es doch sei, wenn jemand Frauen das gibt, was sie brauchen und verdient haben? Haben sich Männer ein anerkennendes Schulterklopfen verdient, nur weil sie Frauen respektvoll behandeln? Nein. Weil sie sich schlichtweg normal verhalten und das erforderliche Standardmaß an Freundlichkeit und Mitgefühl an den Tag legen. Ein solches Verhalten sollte nicht mit Medaillen belohnt werden. Aus ebendiesem Grund widme ich in diesem Buch nicht Seite um Seite der guten, angemessenen und an den Rechten der gebärenden Frauen orientierten Geburtshilfe. Frauen zuzuhören, sie als Individuen zu betrachten und sie im Geburtsraum als zentrale Entscheidungsträgerinnen zu respektieren, sollte nicht mehr als positives Beispiel gelten, sondern als die Norm.
Im Augenblick machen wir die Sache mit den Geburten nicht sonderlich gut. Das spielt vor allem deswegen eine so große Rolle, weil eine Geburt eine prägende Erfahrung im Leben eines Menschen darstellt und Frauen und ihren Partner:innen bis an ihr Lebensende detailreich im Gedächtnis bleibt. In diesem Buch bringe ich einige problematische Aspekte von Geburten zur Sprache. Ziel ist es, Geburten, wie sie heute meist ablaufen, mit anderen Geburten, die ebenfalls möglich und in vielen Fällen auch gewünscht sind, zu vergleichen. Das ist kein leichtes Thema, vor allem deswegen nicht, weil jede Frau anders ist und unterschiedliche Prioritäten hat. Hinzu kommt die Schwere der Emotionen, die jene Frauen, die bereits ein Kind zur Welt gebracht haben und dabei traumatisierende Erfahrungen gemacht oder Machtlosigkeit erlebt haben, in die Diskussion einbringen.
Trotz der Komplexität des Themas und der unterschiedlichen Gefühle, die es auslöst, hoffe ich aber aufrichtig, dass dieses Buch Frauen dazu veranlasst, gemeinsam an diesem Problem zu arbeiten, indem sie einander zuhören und sich im feministischsten Sinne solidarisch zeigen. Wir sind es all jenen, die noch kein Kind zur Welt gebracht haben, schuldig, dass wir der Geburtshilfe eine Richtung verleihen, mit der wir als Kollektiv einverstanden sind.
Die Interventionsrate bei Geburten steigt rasant, und das sollte uns alle beunruhigen. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung. Auch führende Institutionen wie die WHO äußern ihre Besorgnis über die zunehmende Medikalisierung der Geburtshilfe. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Umstand, dass Überwachung, Messung und Kontrolle des Geburtsvorgangs dabei derart in den Fokus geraten, dass die Frage, wie sich die Frauen bei der Geburt fühlen, vollkommen in den Hintergrund gerät – und das bringt die gebärenden Frauen wiederum potenziell um ein zutiefst erfüllendes Erlebnis.
Auch die weltweit angesehenste medizinische Zeitschrift The Lancet rückte den »Zu schnell zu viel«-Ansatz in der Geburtshilfe, der sich vorwiegend in wirtschaftlich starken Ländern findet, in den Fokus. Dort werden Eingriffe, die ursprünglich dazu gedacht waren, Komplikationen zu behandeln, häufig viel zu schnell eingesetzt, was Frauen der Gelegenheit beraubt, sich stark und kompetent zu fühlen.
Beim Lesen wirst du schnell feststellen, dass ich den Problemen rund um die »natürliche« beziehungsweise »spontane« oder »vaginale« Geburt viel Aufmerksamkeit schenke, weil ich den Eindruck habe, dass es sich dabei aus feministischer Sicht um ein zentrales Thema handelt. Wenn ich über natürliche Geburten schreibe, habe ich häufig fast schon das Gefühl, ich würde auf den »Underdog« setzen. Denn wir müssen uns der Tatsache stellen, dass natürliche Geburten – also Geburten, bei denen die Frau ihr Baby ohne Einsatz pharmakologisch wirksamer Stoffe beispielsweise zur Geburtseinleitung, Verstärkung der Wehen oder Austreibung der Plazenta bekommt – derzeit die absolute Ausnahme ist. Eine noch größere Ausnahme sind »Finger-weg«-Geburten, bei denen Frauen nicht »gemanagt« werden, sondern sich auf ihre eigenen Instinkte verlassen, ihrem Körper das Kommando überlassen und nicht in bestimmte Positionen gelenkt oder darin angeleitet werden, wann und wie sie pressen sollen. Frauen, die ihr Baby derart komplett in Eigenregie gebären und dabei gleichzeitig voll auf die liebevolle Unterstützung (und, wenn nötig, auch die medizinische Hilfe) vertrauen können, die im Hintergrund zur Stelle ist, schwärmen häufig richtiggehend von der Erfahrung. Sie sind tief beeindruckt vom Erlebnis, bei dem sie sich selbst als sexuelle Wesen wahrgenommen haben, als sinnlich, stark, vital und selbstbestimmt. Hört man ihre Geschichten, kann man gar nicht anders, als sich zu fragen, wie sehr sich die Welt verändern könnte, wenn mehr Frauen diesen transformativen Kraftschub erleben würden, während sie die Schwelle zum Mutterdasein überschreiten. Doch stattdessen wird es immer »normaler«, sich bei der Geburt alleingelassen, entmächtigt und traumatisiert zu fühlen. Aus diesem Grund halte ich es für wichtig, dass eine Debatte um den Wert entsteht, den diese Art von »spontanem«, »vaginalem« beziehungsweise »natürlichem« Geburtserlebnis für Frauen hat – ein Geburtserlebnis, das derzeit praktisch vom Aussterben bedroht ist.
Darüber hinaus müssen wir über all jene Frauen sprechen, die keine spontanen Vaginalgeburten haben wollen oder können. Es gibt kein einziges Geburtsszenario, in dem es nicht gerechtfertigt wäre, der Frau gegenüber Empathie zu zeigen, auf sie zu hören, ihre Entscheidungen zu respektieren und anzuerkennen, dass dies ein ganz besonderer Tag in ihrem Leben ist. Sprich: Es gibt keine einzige Art von Geburt, die sich nicht verbessern ließe. Und wieder: Die beste Möglichkeit, mehr darüber herauszufinden, besteht darin, Frauen zuzuhören.
Ich habe unendlich viel darüber gelernt, was Frauen bei der Geburt wollen, indem ich mit jenen unter ihnen gesprochen habe, die eine Bauchgeburt erlebt haben, insbesondere unter Vollnarkose – in vielen Fällen eine Geburtserfahrung, die besonders schwer zu verarbeiten ist. Von ihnen habe ich gelernt, dass selbst die kleinsten Gesten einen großen, lebensverändernden Unterschied machen können. Sich beispielsweise einen Moment Zeit zu nehmen, um das Neugeborene auf der Brust der Mutter zu fotografieren, auch wenn diese noch bewusstlos ist, bringt ein Zeugnis hervor, das die Frau ihr Leben lang bewahren wird – ein greifbares Gegenmittel für das Trauma. Immer wieder betonen Frauen, wie viel es ihnen bedeutet, dass ihre Hände zu den ersten zählten, die das Baby berührt haben, auch wenn sie nicht »da« waren, um diesen Augenblick bewusst zu erleben. Jede noch so kleine Geste zählt, und wir können uns immer weiter verbessern.
Diesem Buch liegen zwei radikale Konzepte zugrunde. Erstens, dass Geburten im Leben von Frauen eine bedeutsame Erfahrung darstellen und es an der Zeit ist, damit aufzuhören, Frauen zu erzählen, es handle sich »nur um einen einzigen Tag«, an dem sie »ihre Würde an der Türschwelle abgeben«, weil »ein gesundes Baby das Einzige ist, was zählt«. Das sind altmodische Vorstellungen, die nur so strotzen vor Respektlosigkeit gegenüber Frauen, ihrer Selbstbestimmtheit und ihren Gefühlen – Vorstellungen, die im 21. Jahrhundert nichts zu suchen haben. Dieses Buch ist der Versuch, diese Vorstellungen zu demontieren, indem es einen Blick wirft nicht nur auf die Geschichte von Geburten, sondern auch auf verschiedene feministische Ansätze und die Verbindungen zwischen Geburt, weiblicher Sexualität und Macht sowie auf die aktuelle Kultur der Angst und Entmachtung, die diese veralteten Ideologien stützt. Gleichzeitig möchte ich mit diesem Buch den Versuch wagen, diese veralteten Perspektiven zu ersetzen. Durch neue Denkansätze bezüglich der Rechte von Frauen bei der Geburt und ihrer physischen Integrität (insbesondere durch die Linse der #MeToo-Bewegung). Zudem möchte ich einen frischen Blick auf die räumlichen und zwischenmenschlichen Umstände werfen, die wir in einem Geburtsraum vorfinden würden, der entsprechend den Bedürfnissen von Frauen konzipiert wurde.
Das zweite radikale Konzept, das in diesem Buch vorgestellt wird, besteht darin, dass schwangere Frauen die Rolle der zentralen Entscheidungsträgerin und einflussreichsten Person im Geburtsraum einnehmen sollten. Nachdem ich ein ganzes Jahrzehnt damit verbracht habe, mit Frauen über ihre Erlebnisse in der Geburtshilfe zu sprechen, kann ich versichern, dass zwar regelmäßig wortreich beteuert wird, das sei doch längst der Fall, die Vorstellung in Wahrheit aber Unwohlsein bei den Menschen auslöst. Am deutlichsten zeigt sich das, wenn Frauen gegen den Strom schwimmen, außerhalb der Richtlinien gebären wollen oder sich weigern, ihre Einwilligung zur Standardvorgehensweise zu geben. Diese Frauen – und oft auch die Hebammen oder Doulas, die ihre Entscheidung vorbehaltlos unterstützen – begegnen häufig gewaltigem Widerstand und riskieren Sanktionen oder sogar Strafen, wie mehrere Geschichten in diesem Buch belegen. Ein neues Bewusstsein muss her – das Vertrauen darauf, dass Frauen die richtigen Entscheidungen für sich und ihr Baby treffen. Es muss akzeptiert werden, dass es sich bei dem Image der widerspenstigen, desinformierten, unverantwortlichen oder sogar »verrückten« Frau, der das Wohl ihres Babys nicht am Herzen liegt, um ein schädliches, frauenfeindliches Stereotyp handelt, das als Rechtfertigung dafür benutzt wird, Frauen kontrollieren zu können, auch wenn es in der Realität nur ausgesprochen selten auftritt.
In diesem Buch finden sich zahlreiche Verweise auf die »freie Geburt«, bei der sich Frauen entscheiden, komplett auf die Betreuung durch medizinisches Fachpersonal zu verzichten und einfach selbst zu gebären. Ich gebe offen zu, dass ich mich persönlich niemals entscheiden würde, ohne medizinisches Back-up ein Kind zur Welt zu bringen. Aber ich unterstütze es auf voller Linie, wenn andere Frauen diese Entscheidung treffen. Denn ich glaube, der Schlüssel dazu, dass wir alle frei und selbstbestimmt gebären können, liegt darin, Frauen auch in den Entscheidungen zu unterstützen, die wir so nicht treffen würden. Selbst dann, wenn wir den Eindruck haben, dass diese Entscheidungen schlichtweg »falsch« sind. Wir müssen auf Frauen vertrauen. Und sollte es uns gelingen, diesen Punkt zu erreichen, werden wir womöglich feststellen, dass immer weniger Frauen den Wunsch nach einer freien Geburt oder einer Geburt außerhalb des Systems verspüren. Im Augenblick dagegen wollen verständlicherweise immer weniger Frauen in einem System gebären, das ihnen nicht zuhört, sie nicht respektiert und ihnen kein Vertrauen schenkt.
Egal, ob du dieses Buch als schwangere Frau, Mitglied des Gesundheitssystems oder einfach als an Frauenthemen interessierte Person liest – ich hoffe, es sorgt dafür, dass dir ein Licht aufgeht. Vor allem hoffe ich, dass du Geburten nach dem Lesen als feministisches Thema begreifst, falls du das nicht längst getan hast. Ich hoffe, es bringt dich zum Nachdenken darüber, warum und in welchen Hinsichten Geburten wichtig sind, was weibliche Macht, Handlungsfähigkeit und Autonomie damit zu tun haben und was wir anders und besser machen könnten. Ich hoffe, du findest einige der Dinge, die du auf diesen Seiten liest, aufregend und inspirierend. Gleichzeitig bin ich sicher, dass es Passagen gibt, die du so absolut nicht unterschreiben würdest, die du lieber nicht hören würdest und die dich vielleicht sogar wütend machen. All das ist in Ordnung. Wie ich meiner liebenswürdigen inneren Kritikerin immer wieder einbläue: Es wird viele verschiedene Reaktionen auf dieses Buch geben, und letzten Endes sind sie alle – »gute« wie »schlechte« – Stimmen, die wir dringend brauchen. Einfach, weil sie einen Beitrag zu der Debatte über Geburten als feministisches Thema liefern. Und das ist wichtig, wenn wir eine Zukunft erschaffen wollen, in der Frauen genau die positiven Geburtserfahrungen machen, nach denen sie sich so verzweifelt sehnen, die medizinische Hilfe erhalten, die sie wirklich brauchen, und die Macht, den Respekt und die Selbstbestimmung erhalten, die sie so unbedingt verdient haben. Lasst uns diese Debatte ins Rollen bringen.
Wir alle bilden uns gern ein, dass wir freie Entscheidungen treffen, aber wir alle sind ein Produkt unserer Kultur, der Geschichten, die wir gehört, der Werbungen und Fernsehserien, die wir gesehen und der Erwartungen, die wir auf dieser Grundlage bezüglich der verschiedensten Ereignisse entwickelt haben. Gebärt man beispielsweise im Bett auf dem Rücken liegend, mag sich das nach freier Entscheidung anfühlen – aber dieser Entscheidung liegt eine Myriade an Einflüssen zugrunde, von Fernseh-Dokus, in denen typische Krankenhausgeburten gezeigt werden, bis hin zu der Tatsache, dass im Zentrum der meisten Geburtsräume ein riesiges Bett steht. All diese Einflüsse haben womöglich dazu geführt, dass man denkt, so würden „Geburten eben ablaufen“. Der Feminismus muss tiefer graben. Er muss Entscheidungen rund um Geburten und die Erfahrungen, die Frauen beim Gebären machen, im Licht der Menschenrechte neu bewerten und dadurch eine Welt erschaffen, in der gebärende Frauen eine deutlich größere Bandbreite an Entscheidungen treffen können.
Einführung oder Vorwort
Während ich dieses Buch geschrieben habe, gab es immer wieder Augenblicke, in denen ich mich fragte: Wieso eigentlich ich? Da war sie mal wieder, diese kritische kleine Stimme in mir. (Und versucht bloß nicht, mir einzureden, ihr wüsstet nicht genau, wovon ich rede!) Sie sagte: »Milli, bist du wirklich sicher, dass du auch noch diese Büchse der Pandora öffnen willst? Hat es dir ehrlich nicht gereicht, einen Diskurs über Geburten anzustoßen? Und jetzt kommst du auch noch mit der Tretmine Feminismus daher? Sag mal, spinnst du eigentlich? Man wird dich teeren und federn – na ja, zumindest bildlich gesprochen.« Ich sollte vielleicht anmerken, dass die kritische kleine Stimme in mir einen eher fragwürdigen Humor hat.
Aber sie hat schon recht: Es ist nicht leicht, über Geburten zu sprechen und noch viel weniger, feministische Themen anzuschneiden. Das geht oft ja schon bei der Frage los, was Feminismus überhaupt ist. Wobei ich selbst in dieser Hinsicht einen ziemlich simplen Ansatz fahre: Feminismus bedeutet, es zu erkennen, wenn Frauen ungerecht behandelt werden, und etwas dagegen zu tun. Und genau da liegt das Problem, wenn es um Geburten geht: Viel zu wenige Menschen bemerken überhaupt, dass Frauen in diesem Zusammenhang ungerecht behandelt werden, und noch viel weniger tun etwas dagegen. Wir sind blind für das massive Machtgefälle im Geburtsraum und haben aus ungeklärten Gründen einfach akzeptiert, dass Geburten nun einmal eine unangenehme und ziemlich würdelose Angelegenheit sind – wenn nicht sogar übergriffig, traumatisierend und erniedrigend. »Tja, so ist das eben!«, heißt es dann. Deswegen schreibe ich dieses Buch: Um euch zu sagen, dass es auch anders laufen kann. Und dass wir als Feministinnen diesen Status quo nicht länger hinzunehmen brauchen.
Feminismus muss nicht kompliziert sein, und er braucht auch nicht exkludierend zu sein. Zu gebären wie eine Feministin, muss nicht bedeuten, dass man auf eine ganz bestimmte Art und Weise gebiert, ebenso wenig wie das Prädikat »feministisch« in irgendeinem anderen Lebensbereich – sei es im Beruf, in der Beziehung oder bei der Kindererziehung – bedeutet, dass nur eine einzige Handlungsoption die richtige ist. Du kannst in jeder Umgebung und auf jede Weise feministisch gebären – von der geplanten Sectio in einem Privatkrankenhaus bis hin zur freien Geburt im Meer. Du brauchst nur eins zu tun: die passive Einstellung abzuschütteln, dass Geburten etwas sind, das dir passiert und das sich deiner Kontrolle entzieht, und zu erkennen, dass du ziemlich schlecht dabei wegkommen könntest, wenn du nicht aufwachst und das Ruder in die Hand nimmst. Kurz gesagt: Übernimm die Verantwortung und die Kontrolle und triff bewusste Entscheidungen.
Wenn ich auf Mainstream-Events rund um das Thema Geburten Vorträge halte, schockiert es mich immer wieder aufs Neue, dass viele Frauen und ihre Partner:innen es als Offenbarung verstehen, wenn man ihnen mitteilt, dass sie im Geburtsraum Rechte haben und selbstbestimmt entscheiden können. Viele Menschen erleben sich während Wehen und Geburt nicht als selbstbestimmte, starke Individuen und haben auch nicht den Eindruck, Einfluss auf den Ablauf der Geburt nehmen zu können. Häufig sind sie falsch informiert, zum Teil auch, weil sie von vornherein mit der Überzeugung in die Schwangerschaft hineingehen, sie hätten kaum oder nur wenige Handlungsmöglichkeiten, weswegen sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sich tiefergehend zu informieren. Was soll es in einem Umfeld, in dem mit beunruhigender Häufigkeit der Ausdruck »nicht erlaubt« zum Einsatz kommt, schon bringen, sich über seine Möglichkeiten zu informieren? Die meisten Paare, die ein Kind erwarten, glauben, dass die Mehrheit der Entscheidungen nicht in ihren Händen liegt.
In der Praxis bedeutet das, dass tagtäglich Frauen, die nicht wissen, dass sie den Eingriff verweigern können, Finger in die Vagina geschoben werden. Wie kann es sein, dass wir das stillschweigend akzeptieren? Selbst in den fortschrittlichsten Diskussionen um das Thema Geburt wird der Ausdruck »informierte Einwilligung« genutzt, der unausgesprochen voraussetzt, dass das Ziel in der Einwilligung besteht, nicht etwa in einem Entscheidungsprozess oder sogar einer informierten Weigerung. Eine Fachkraft in der Geburtshilfe sagt beispielsweise, dass sie »kurz die Einwilligung einholen geht«, als wäre sie die aktive Person in diesem Austausch und die Frau passiv. Es ist an der Zeit, das System infrage zu stellen, das diesen Mythos der bedingungslosen Kooperation und Machtlosigkeit der Frau aufrechterhält.
Erhebt man Beschwerde über Erfahrungen, die typischerweise nur Frauen machen, wird man häufig direkt darauf aufmerksam gemacht, wie selten und »nischig« das Problem doch sei und wie gut es die meisten Frauen doch hätten. Diese Taktik der thematischen Verschiebung wird durch das Hashtag #NotAllMen wunderbar versinnbildlicht. Frauen sollen damit daran erinnert werden, wie viele gute, ausgeglichene Männer da draußen herumlaufen, sobald sie irgendein Problem auf den Tisch bringen, sei es Mansplaining oder Vergewaltigung. »#NotAllMen sind Vergewaltiger. #NotAllMen sind sexistisch. Nicht vergessen, #NotAllMen schlagen ihre Frauen.« Aber Moment mal, sagen dann die Frauen, uns geht es doch auch gar nicht um den großen Prozentsatz wunderbarer Männer, die respektvoll mit Frauen umgehen. Uns geht es um die anderen, die es nicht tun. Aber durch das Ablenkungsmanöver wurde der eigentliche Punkt bereits verwässert, wodurch der Aggressor auf einmal in die Opferrolle versetzt wird.
Ebendieses Manöver wird auch im Diskurs über Geburten angewendet. Thematisiert man gegenüber Angestellten des Gesundheitswesens Probleme wie medizinische Eingriffe, denen nicht zugestimmt wurde; institutionalisierte Frauenfeindlichkeit; dass Frauen in den Wehen nicht richtig zugehört wird oder auch Rassismus in der Geburtshilfe, bekommt man häufig Reaktionen zu hören wie: »Wo ich arbeite, ist das nicht so«, »Nicht alle Hebammen sind so«, »Es sollten nicht alle über einen Kamm geschert werden«.
Bevor wir uns also auf die Reise durch dieses Buch begeben, möchte ich betonen, dass ich mich hier nicht auf individuelle Personen konzentrieren möchte, sondern auf die Systeme, in denen sie handeln. Die Geburtshilfe ist ein System, das infrage gestellt werden muss, ebenso wie das System, auf dem es aufbaut und in das es ein10
Einführung
gebettet ist – das Patriarchat. Bitte lenke nicht von diesem wichtigen Thema ab, nur weil du selbst eine Arbeitsweise an den Tag legst, die Frauen als selbstbestimmte Wesen respektiert, oder weil du während deiner eigenen Schwangerschaft eine wunderbare Betreuung erfahren hast. Beides ist toll – aber es ist nicht das Thema dieses Buches.
Ähnlich wird manchmal dazu aufgerufen, dass mehr über die wunderbaren Männer – oder eben die wunderbaren Geburtshelferinnen und -helfer – gesprochen werden sollte, die »es richtig machen«. Und natürlich, ja: Da draußen gibt es eine Menge hervorragender Hebammen, Ärztinnen und Ärzte, Geburtsstationen und Organisationen, die eine fantastische, auf die jeweilige Frau zentrierte Geburtshilfe leisten. Und ja: Lob ist etwas Wunderbares. Und ja: Ein paar von ihnen tauchen in diesem Buch auf. Aber müssen wir wirklich wieder und wieder betonen, wie fantastisch es doch sei, wenn jemand Frauen das gibt, was sie brauchen und verdient haben? Haben sich Männer ein anerkennendes Schulterklopfen verdient, nur weil sie Frauen respektvoll behandeln? Nein. Weil sie sich schlichtweg normal verhalten und das erforderliche Standardmaß an Freundlichkeit und Mitgefühl an den Tag legen. Ein solches Verhalten sollte nicht mit Medaillen belohnt werden. Aus ebendiesem Grund widme ich in diesem Buch nicht Seite um Seite der guten, angemessenen und an den Rechten der gebärenden Frauen orientierten Geburtshilfe. Frauen zuzuhören, sie als Individuen zu betrachten und sie im Geburtsraum als zentrale Entscheidungsträgerinnen zu respektieren, sollte nicht mehr als positives Beispiel gelten, sondern als die Norm.
Im Augenblick machen wir die Sache mit den Geburten nicht sonderlich gut. Das spielt vor allem deswegen eine so große Rolle, weil eine Geburt eine prägende Erfahrung im Leben eines Menschen darstellt und Frauen und ihren Partner:innen bis an ihr Lebensende detailreich im Gedächtnis bleibt. In diesem Buch bringe ich einige problematische Aspekte von Geburten zur Sprache. Ziel ist es, Geburten, wie sie heute meist ablaufen, mit anderen Geburten, die ebenfalls möglich und in vielen Fällen auch gewünscht sind, zu vergleichen. Das ist kein leichtes Thema, vor allem deswegen nicht, weil jede Frau anders ist und unterschiedliche Prioritäten hat. Hinzu kommt die Schwere der Emotionen, die jene Frauen, die bereits ein Kind zur Welt gebracht haben und dabei traumatisierende Erfahrungen gemacht oder Machtlosigkeit erlebt haben, in die Diskussion einbringen.
Trotz der Komplexität des Themas und der unterschiedlichen Gefühle, die es auslöst, hoffe ich aber aufrichtig, dass dieses Buch Frauen dazu veranlasst, gemeinsam an diesem Problem zu arbeiten, indem sie einander zuhören und sich im feministischsten Sinne solidarisch zeigen. Wir sind es all jenen, die noch kein Kind zur Welt gebracht haben, schuldig, dass wir der Geburtshilfe eine Richtung verleihen, mit der wir als Kollektiv einverstanden sind.
Die Interventionsrate bei Geburten steigt rasant, und das sollte uns alle beunruhigen. Das ist nicht nur meine persönliche Meinung. Auch führende Institutionen wie die WHO äußern ihre Besorgnis über die zunehmende Medikalisierung der Geburtshilfe. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Umstand, dass Überwachung, Messung und Kontrolle des Geburtsvorgangs dabei derart in den Fokus geraten, dass die Frage, wie sich die Frauen bei der Geburt fühlen, vollkommen in den Hintergrund gerät – und das bringt die gebärenden Frauen wiederum potenziell um ein zutiefst erfüllendes Erlebnis.
Auch die weltweit angesehenste medizinische Zeitschrift The Lancet rückte den »Zu schnell zu viel«-Ansatz in der Geburtshilfe, der sich vorwiegend in wirtschaftlich starken Ländern findet, in den Fokus. Dort werden Eingriffe, die ursprünglich dazu gedacht waren, Komplikationen zu behandeln, häufig viel zu schnell eingesetzt, was Frauen der Gelegenheit beraubt, sich stark und kompetent zu fühlen.
Beim Lesen wirst du schnell feststellen, dass ich den Problemen rund um die »natürliche« beziehungsweise »spontane« oder »vaginale« Geburt viel Aufmerksamkeit schenke, weil ich den Eindruck habe, dass es sich dabei aus feministischer Sicht um ein zentrales Thema handelt. Wenn ich über natürliche Geburten schreibe, habe ich häufig fast schon das Gefühl, ich würde auf den »Underdog« setzen. Denn wir müssen uns der Tatsache stellen, dass natürliche Geburten – also Geburten, bei denen die Frau ihr Baby ohne Einsatz pharmakologisch wirksamer Stoffe beispielsweise zur Geburtseinleitung, Verstärkung der Wehen oder Austreibung der Plazenta bekommt – derzeit die absolute Ausnahme ist. Eine noch größere Ausnahme sind »Finger-weg«-Geburten, bei denen Frauen nicht »gemanagt« werden, sondern sich auf ihre eigenen Instinkte verlassen, ihrem Körper das Kommando überlassen und nicht in bestimmte Positionen gelenkt oder darin angeleitet werden, wann und wie sie pressen sollen. Frauen, die ihr Baby derart komplett in Eigenregie gebären und dabei gleichzeitig voll auf die liebevolle Unterstützung (und, wenn nötig, auch die medizinische Hilfe) vertrauen können, die im Hintergrund zur Stelle ist, schwärmen häufig richtiggehend von der Erfahrung. Sie sind tief beeindruckt vom Erlebnis, bei dem sie sich selbst als sexuelle Wesen wahrgenommen haben, als sinnlich, stark, vital und selbstbestimmt. Hört man ihre Geschichten, kann man gar nicht anders, als sich zu fragen, wie sehr sich die Welt verändern könnte, wenn mehr Frauen diesen transformativen Kraftschub erleben würden, während sie die Schwelle zum Mutterdasein überschreiten. Doch stattdessen wird es immer »normaler«, sich bei der Geburt alleingelassen, entmächtigt und traumatisiert zu fühlen. Aus diesem Grund halte ich es für wichtig, dass eine Debatte um den Wert entsteht, den diese Art von »spontanem«, »vaginalem« beziehungsweise »natürlichem« Geburtserlebnis für Frauen hat – ein Geburtserlebnis, das derzeit praktisch vom Aussterben bedroht ist.
Darüber hinaus müssen wir über all jene Frauen sprechen, die keine spontanen Vaginalgeburten haben wollen oder können. Es gibt kein einziges Geburtsszenario, in dem es nicht gerechtfertigt wäre, der Frau gegenüber Empathie zu zeigen, auf sie zu hören, ihre Entscheidungen zu respektieren und anzuerkennen, dass dies ein ganz besonderer Tag in ihrem Leben ist. Sprich: Es gibt keine einzige Art von Geburt, die sich nicht verbessern ließe. Und wieder: Die beste Möglichkeit, mehr darüber herauszufinden, besteht darin, Frauen zuzuhören.
Ich habe unendlich viel darüber gelernt, was Frauen bei der Geburt wollen, indem ich mit jenen unter ihnen gesprochen habe, die eine Bauchgeburt erlebt haben, insbesondere unter Vollnarkose – in vielen Fällen eine Geburtserfahrung, die besonders schwer zu verarbeiten ist. Von ihnen habe ich gelernt, dass selbst die kleinsten Gesten einen großen, lebensverändernden Unterschied machen können. Sich beispielsweise einen Moment Zeit zu nehmen, um das Neugeborene auf der Brust der Mutter zu fotografieren, auch wenn diese noch bewusstlos ist, bringt ein Zeugnis hervor, das die Frau ihr Leben lang bewahren wird – ein greifbares Gegenmittel für das Trauma. Immer wieder betonen Frauen, wie viel es ihnen bedeutet, dass ihre Hände zu den ersten zählten, die das Baby berührt haben, auch wenn sie nicht »da« waren, um diesen Augenblick bewusst zu erleben. Jede noch so kleine Geste zählt, und wir können uns immer weiter verbessern.
Diesem Buch liegen zwei radikale Konzepte zugrunde. Erstens, dass Geburten im Leben von Frauen eine bedeutsame Erfahrung darstellen und es an der Zeit ist, damit aufzuhören, Frauen zu erzählen, es handle sich »nur um einen einzigen Tag«, an dem sie »ihre Würde an der Türschwelle abgeben«, weil »ein gesundes Baby das Einzige ist, was zählt«. Das sind altmodische Vorstellungen, die nur so strotzen vor Respektlosigkeit gegenüber Frauen, ihrer Selbstbestimmtheit und ihren Gefühlen – Vorstellungen, die im 21. Jahrhundert nichts zu suchen haben. Dieses Buch ist der Versuch, diese Vorstellungen zu demontieren, indem es einen Blick wirft nicht nur auf die Geschichte von Geburten, sondern auch auf verschiedene feministische Ansätze und die Verbindungen zwischen Geburt, weiblicher Sexualität und Macht sowie auf die aktuelle Kultur der Angst und Entmachtung, die diese veralteten Ideologien stützt. Gleichzeitig möchte ich mit diesem Buch den Versuch wagen, diese veralteten Perspektiven zu ersetzen. Durch neue Denkansätze bezüglich der Rechte von Frauen bei der Geburt und ihrer physischen Integrität (insbesondere durch die Linse der #MeToo-Bewegung). Zudem möchte ich einen frischen Blick auf die räumlichen und zwischenmenschlichen Umstände werfen, die wir in einem Geburtsraum vorfinden würden, der entsprechend den Bedürfnissen von Frauen konzipiert wurde.
Das zweite radikale Konzept, das in diesem Buch vorgestellt wird, besteht darin, dass schwangere Frauen die Rolle der zentralen Entscheidungsträgerin und einflussreichsten Person im Geburtsraum einnehmen sollten. Nachdem ich ein ganzes Jahrzehnt damit verbracht habe, mit Frauen über ihre Erlebnisse in der Geburtshilfe zu sprechen, kann ich versichern, dass zwar regelmäßig wortreich beteuert wird, das sei doch längst der Fall, die Vorstellung in Wahrheit aber Unwohlsein bei den Menschen auslöst. Am deutlichsten zeigt sich das, wenn Frauen gegen den Strom schwimmen, außerhalb der Richtlinien gebären wollen oder sich weigern, ihre Einwilligung zur Standardvorgehensweise zu geben. Diese Frauen – und oft auch die Hebammen oder Doulas, die ihre Entscheidung vorbehaltlos unterstützen – begegnen häufig gewaltigem Widerstand und riskieren Sanktionen oder sogar Strafen, wie mehrere Geschichten in diesem Buch belegen. Ein neues Bewusstsein muss her – das Vertrauen darauf, dass Frauen die richtigen Entscheidungen für sich und ihr Baby treffen. Es muss akzeptiert werden, dass es sich bei dem Image der widerspenstigen, desinformierten, unverantwortlichen oder sogar »verrückten« Frau, der das Wohl ihres Babys nicht am Herzen liegt, um ein schädliches, frauenfeindliches Stereotyp handelt, das als Rechtfertigung dafür benutzt wird, Frauen kontrollieren zu können, auch wenn es in der Realität nur ausgesprochen selten auftritt.
In diesem Buch finden sich zahlreiche Verweise auf die »freie Geburt«, bei der sich Frauen entscheiden, komplett auf die Betreuung durch medizinisches Fachpersonal zu verzichten und einfach selbst zu gebären. Ich gebe offen zu, dass ich mich persönlich niemals entscheiden würde, ohne medizinisches Back-up ein Kind zur Welt zu bringen. Aber ich unterstütze es auf voller Linie, wenn andere Frauen diese Entscheidung treffen. Denn ich glaube, der Schlüssel dazu, dass wir alle frei und selbstbestimmt gebären können, liegt darin, Frauen auch in den Entscheidungen zu unterstützen, die wir so nicht treffen würden. Selbst dann, wenn wir den Eindruck haben, dass diese Entscheidungen schlichtweg »falsch« sind. Wir müssen auf Frauen vertrauen. Und sollte es uns gelingen, diesen Punkt zu erreichen, werden wir womöglich feststellen, dass immer weniger Frauen den Wunsch nach einer freien Geburt oder einer Geburt außerhalb des Systems verspüren. Im Augenblick dagegen wollen verständlicherweise immer weniger Frauen in einem System gebären, das ihnen nicht zuhört, sie nicht respektiert und ihnen kein Vertrauen schenkt.
Egal, ob du dieses Buch als schwangere Frau, Mitglied des Gesundheitssystems oder einfach als an Frauenthemen interessierte Person liest – ich hoffe, es sorgt dafür, dass dir ein Licht aufgeht. Vor allem hoffe ich, dass du Geburten nach dem Lesen als feministisches Thema begreifst, falls du das nicht längst getan hast. Ich hoffe, es bringt dich zum Nachdenken darüber, warum und in welchen Hinsichten Geburten wichtig sind, was weibliche Macht, Handlungsfähigkeit und Autonomie damit zu tun haben und was wir anders und besser machen könnten. Ich hoffe, du findest einige der Dinge, die du auf diesen Seiten liest, aufregend und inspirierend. Gleichzeitig bin ich sicher, dass es Passagen gibt, die du so absolut nicht unterschreiben würdest, die du lieber nicht hören würdest und die dich vielleicht sogar wütend machen. All das ist in Ordnung. Wie ich meiner liebenswürdigen inneren Kritikerin immer wieder einbläue: Es wird viele verschiedene Reaktionen auf dieses Buch geben, und letzten Endes sind sie alle – »gute« wie »schlechte« – Stimmen, die wir dringend brauchen. Einfach, weil sie einen Beitrag zu der Debatte über Geburten als feministisches Thema liefern. Und das ist wichtig, wenn wir eine Zukunft erschaffen wollen, in der Frauen genau die positiven Geburtserfahrungen machen, nach denen sie sich so verzweifelt sehnen, die medizinische Hilfe erhalten, die sie wirklich brauchen, und die Macht, den Respekt und die Selbstbestimmung erhalten, die sie so unbedingt verdient haben. Lasst uns diese Debatte ins Rollen bringen.