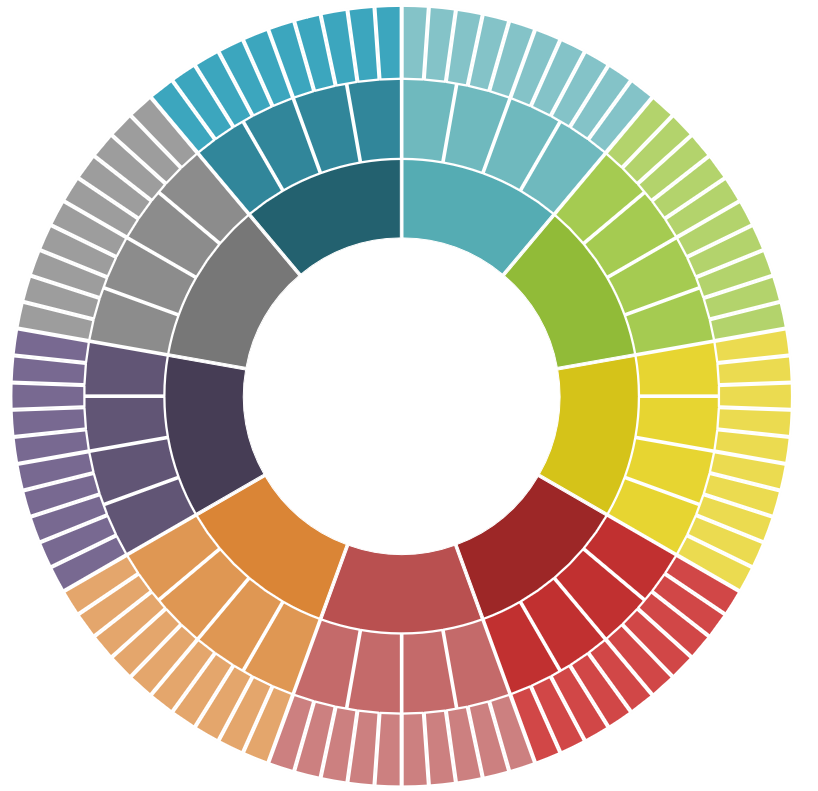Volltextsuche nutzen
- versandkostenfrei ab € 30,–
- 11x in Wien, NÖ und Salzburg
- 6 Mio. Bücher
- facultas
- Detailansicht

Wer um Liebe ringt

Taschenbuch
16,40€
inkl. gesetzl. MwSt.
Besorgungstitel
Lieferzeit 1-2 WochenVersandkostenfrei ab 30,00 € österreichweit
Lieferzeit 1-2 WochenVersandkostenfrei ab 30,00 € österreichweit
unter € 30,00 österreichweit: € 4,90
Deutschland: € 10,00
EU & Schweiz: € 20,00
Deutschland: € 10,00
EU & Schweiz: € 20,00
In den Warenkorb
Click & Collect
Artikel online bestellen und in der Filiale abholen.
Derzeit in keiner facultas Filiale lagernd. Jetzt online bestellen!Artikel online bestellen und in der Filiale abholen.
Artikel in den Warenkorb legen, zur Kassa gehen und Wunschfiliale auswählen. Lieferung abholen und bequem vor Ort bezahlen.
Auf die Merkliste
Veröffentlicht 2016, von Tamera Alexander bei Francke-Buch, Zondervan Corporation L.L.C., a subsidiary of HarperCollins Christian Publishing, Inc., USA
ISBN: 978-3-86827-555-1
Auflage: 1. Auflage
448 Seiten
20.5 cm x 13.5 cm
Nashville, 1869. Maggie Linden ist eine passionierte Reiterin und trainiert ihr Pferd Bourbon Belle für ein großes Rennen. Doch als der Farm ihres Vaters die Zwangsversteigerung droht, scheinen ihre Träume zu zerplatzen. Unterdessen versucht der attraktive, etwas kantige irische Einwanderer Cullen McGrath in Tennessee Fuß zu fassen. Überall stößt er auf verschlossene Türen, bis Maggies ...
Beschreibung
Nashville, 1869. Maggie Linden ist eine passionierte Reiterin und trainiert ihr Pferd Bourbon Belle für ein großes Rennen. Doch als der Farm ihres Vaters die Zwangsversteigerung droht, scheinen ihre Träume zu zerplatzen. Unterdessen versucht der attraktive, etwas kantige irische Einwanderer Cullen McGrath in Tennessee Fuß zu fassen. Überall stößt er auf verschlossene Türen, bis Maggies Vater ihm ein ungewöhnliches Angebot macht …
Eine spannende, manchmal zum Weinen und manchmal zum Lachen bringende Geschichte von Menschen, die gegen alle Konventionen ihren Überzeugungen und Träumen folgen.
Erstes Kapitel
Kapitel 1
Nashville, Tennessee
4. Mai 1869
„Ruhig, Mädchen“, flüsterte Maggie, während sie die Lederzügel fest in den Händen hielt und von der Felswand hinabschaute. Das Stimmengewirr der Zuschauer auf der Rennbahn unter ihr wehte im kühlen Morgenwind zu ihr herauf. Sie beugte sich vor, um dem Vollblutpferd den Hals zu streicheln. „Warte nur“, flüsterte sie beruhigend und spürte die gespannte Vorfreude, die in der Luft lag. „Unser Tag wird kommen.“ Noch während sie das sagte, schlug ihr eigener Puls ein wenig höher.
Bourbon Belle scharrte auf der Erde und Maggie spürte, dass die Stute mit jeder Sekunde ungeduldiger wurde.
Der Startschuss ertönte. Die Pferde auf der Rennbahn unter ihnen stürmten genauso los wie Bourbon Belle über ihnen auf dem Felsplateau. Eine unbändige Freude schoss durch Maggies Adern.
Belle erwachte zum Leben. Maggie überließ dem Pferd die Führung und erlaubte der Stute, jedem Instinkt zu folgen, den ihr der muskulöse Körper eingab – dem unbändigen Instinkt zu laufen.
Belles Hufe polterten über den glatten Feldweg und Maggie ahnte, dass Willie dieses Gefühl erlebte, wenn er mit Belle unten auf der Rennbahn mit den anderen um den Sieg ritt. Allerdings war der Junge nur halb so schwer wie Maggie, sodass er und Belle fast über den Boden flogen. So würde es auch wieder beim Rennen in ein paar Tagen sein.
Die Strecke war nur zwei Kilometer lang und das Rennen dauerte kaum zwei Minuten. Das Hämmern ihres Herzens war Maggies Zeitmesser, als Belle um die vertraute Kurve auf dem Weg bog und die kräftig ausholenden Beine der Stute die Strecke im Nu zurücklegten.
Maggie beugte sich vor, wie sie es mit Willie immer eintrainierte. Sie fühlte, wie der Wind die Nadeln aus ihren Haaren zerrte, und genoss die Freiheit, die man nur bei einem solchen Ritt erlebte. Obwohl sie wusste, dass dieser Friede bestenfalls von kurzer Dauer sein würde, kostete sie ihn in vollen Zügen aus.
Belles Hufe polterten und Maggie trieb sie an, während die letzte Wegstrecke vor ihnen auftauchte. In diesem Moment stiegen unterhalb von ihnen Jubelrufe von der Rennbahn auf. Als Maggie kurz den Kopf drehte, sah sie ein Vollblutpferd, das in diesem Moment die Ziellinie passierte. Belle galoppierte mit voller Kraft weiter und verlangsamte ihr Tempo erst, als Maggie an den Zügeln zog.
Atemlos hielt Maggie an und genoss den süßen Duft des Grases in vollen Zügen. Sie beugte sich vor, um Belle zwischen den Ohren zu streicheln. „Gut gemacht, Mädchen.“ Maggie atmete tief ein. „Dass wir nicht noch schneller waren, lag allein an mir.“
Belle wieherte, als wolle sie ihr recht geben, und Maggie lächelte.
Die Siegesprämie bei dem bevorstehenden Rennen – falls Willie und Belle das Rennen gewannen, wovon Maggie felsenfest überzeugt war – würde nicht annähernd ausreichen, um die ausstehenden Steuerschulden für Linden Downs zu zahlen. Aber sie hoffte, dass das Geld genügen würde, um das Grundsteueramt etwas milde zu stimmen. Wieder einmal.
Belle hatte bereits die letzten fünf Ausscheidungsrennen gewonnen und angesichts der vielen Veranstaltungen auf der Burns-Island-Rennbahn rechnete Maggie in den nächsten Monaten mit einer relativ sicheren Einnahmequelle. Aber Maggies großes Ziel war das Peyton Stakes im Herbst, das größte Pferderennen im ganzen Land mit der höchsten Siegprämie der Geschichte. Dieses Rennen würde hier in Nashville ausgetragen werden. Die Frage war nur, ob Linden Downs sich bis dahin über Wasser halten konnte. Ihre Bourbon Belle, die dreijährige Stute, die sie schon als Fohlen aufgezogen hatte, würde auch dieses Rennen gewinnen – die Wettkampfzeiten der Stute bewiesen das ohne jeden Zweifel. Maggie hoffte nur, dass keine unvorhergesehene Konkurrenz antreten würde. Trotz ihres Vertrauens in die Fähigkeiten ihrer Stute empfand sie die nächsten Monate wie eine unüberwindliche Hürde. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie und ihr Vater, obwohl sie so lange durchgehalten hatten, ihr Zuhause in letzter Minute doch noch verlieren könnten.
Maggie stieg ab und war dankbar für die Gelegenheit, sich die Beine zu vertreten und Belle abkühlen zu lassen, bevor sie nach Hause ritten. Aber als die Minuten verstrichen und sich die Aufregung wegen des Rennens auf der Rennbahn unter ihnen legte, wurde Maggie die Tragweite ihrer Situation wieder mit voller Wucht bewusst.
Wie war es so weit gekommen? Zu diesem schmerzlichen Niedergang von etwas, das sie mit so großer Anstrengung hatten zusammenhalten wollen? Aber sie weigerte sich, die Verzweiflung siegen zu lassen. Sie würde nicht aufgeben.
Sie hatte einen Jockey, der in nur vier Tagen zum Rennen antreten würde.
Sie könnten es schaffen. Mit Belle und mit Linden Downs. Eine andere Wahl blieb ihr nicht. Ihr Vater war so lange ihr Schutz und ihre Zuflucht gewesen – nun war es ihre Aufgabe, für ihn zu sorgen.
Maggie hob ihren Beutel und ihr Gewehr auf, das sie vor dem Rennen abgelegt hatte. Den Beutel stopfte sie in die Satteltasche und ihr Gewehr schob sie in das Halfter, das daran befestigt war. Pferderennen und Schießen an einem einzigen Tag – das empfand sie als großen Segen … aber irgendwie schien dieses Wort für diese beiden Tätigkeiten nicht ganz zu passen.
Sie schwang sich wieder in den Sattel und lenkte Belle nach Hause. Schnell stellte sie fest, dass die Stute keine Lust hatte, gemütlich zu traben oder nur in einem kurzen Galopp zu laufen. Das Voll-
blutpferd wollte das tun, was es am besten konnte.
Maggie ließ ihm gerne freien Lauf.
Cullen McGrath kniete am Flussufer und blickte in das trübe Wasser des Cumberland River. Doch seine Augen sahen nur die dunklen Schatten der salzigen Meerestiefen, die seine Welt verschlungen hatten. Er war eigentlich nie ein Mann gewesen, der seine Entscheidungen infrage stellte. Doch seit er vor einem Jahr zum ersten Mal seine schmutzigen Stiefel auf den Boden dieses Landes gesetzt hatte, wurde er öfter von Zweifeln geplagt.
Auch das tiefe Bedauern hatte sich als ein grausamer Begleiter seiner Gedanken erwiesen. Aber einer Sache war er sich sicher:
„Ich halte das Versprechen, das ich dir gegeben habe“, flüsterte er in die feuchte Morgenluft hinein. „Koste es, was es wolle.“ Wurden Versprechen, die auf dieser Erde laut ausgesprochen wurden, in der nächsten Welt gehört? Er hoffte es. Wenigstens in diesem Moment. Sein Großvater, der oft von solchen Dingen gesprochen hatte, hatte ihm das versichert.
Ja, Cullen, mein Junge. Nur Narren glauben, dass dieses Leben alles wäre. Die Welt, die nach diesem Leben kommt, ist viel größer. Und das Geheimnis für ein erfülltes Leben auf dieser Erde liegt darin, dass wir den Blick auf das Leben danach richten. Vergiss nie, dass du …
„Hey! Du da drüben! Das Pferd ist bereit.“
Cullen verzog das Gesicht, als er so unsanft aus seinen Gedanken gerissen wurde, obwohl der vertraute irische Akzent seines Großvaters noch wie der Morgennebel seine Gedanken überlagerte. Als Junge hatte man ihm gesagt, dass er genauso spreche wie sein Großvater. Diesen Vergleich hatte er aber erst in den letzten Jahren richtig zu schätzen gelernt.
Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf, doch als er sich umdrehen wollte, fiel sein Blick auf eine Bewegung auf der anderen Seite des Flusses. Ein Pferd schoss mit seinem Reiter in rasender Geschwindigkeit vorbei. Schnell wie ein Blitz. Er kniff die Augen zusammen. Das konnte doch nicht sein!
Da wehte ein Rock hinter dem Reiter her. Es schien ein zierliches Mädchen zu sein – oder war es eine Frau? Das war aus dieser Entfernung heraus nur schwer zu sagen. Sie ritt jedenfalls mit einer Freiheit und Leidenschaft, die ihn wehmütig an ein anderes Leben erinnerte. Und sie ritt auch noch in einem Männersattel! Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Ein solches Tempo und eine solche Anmut hatte er bei keinem Pferd mehr gesehen, seit Bonnie Scotland damals wie der Wind …
„Hey! Hörst du mir überhaupt zu, Junge?“
Junge? Missmutig drehte sich Cullen um und richtete seinen Blick auf den Koloss von einem Mann, der mit den Zügeln in der Hand wartend dastand.
Es war nicht der Schmied, der gleichzeitig Eigentümer des Mietstalls war. Er hatte Cullens Angebot vor einer Stunde angenommen – wenn auch nur zähneknirschend, wie er aus dem Widerstreben des Schmieds, das Geschäft per Handschlag festzumachen, schloss. Aber diesen Mann hatte Cullen auch schon gesehen. Er war ein paar Jahre jünger als er selbst und sah ziemlich eingebildet aus. Er war kurze Zeit, nachdem der Schmied den Verkauf mit Cullen festgemacht hatte, in den Stall gekommen und hatte ihr Gespräch verfolgt.
Cullen ging auf den Mann zu. Die Angriffslust, die dieser ausstrahlte, war fast zum Greifen nahe. Verachtung lag in seinem Blick. Früher hätte er diesem Mann einen Fausthieb verpasst, wenn er ihn nur schief angesehen hätte. Aber Cullen bezweifelte, dass ein einziger Schlag einen Mann von dieser Statur zu Boden werfen würde.
Da er ihm an Kraft aber in nichts nachzustehen schien, schätzte Cullen, dass ein gut gezielter Fausthieb ihn zumindest ins Wanken bringen könnte. Wenn er an die Wut dachte, die sich in den letzten Monaten in ihm aufgestaut hatte, würde es sich gut anfühlen, diesen Typen seine Faust spüren zu lassen, damit ihm sein eingebildetes, hämisches Grinsen verginge.
Aber er wollte das Geschäft, das er abgeschlossen hatte, nicht verderben und erwiderte deshalb nur furchtlos den direkten Blick des Mannes, statt alten Instinkten nachzugeben. Er holte eine Packung Geldscheine aus seiner Hemdtasche und zählte sie mit einer Höflichkeit ab, die ihm in den Monaten, in denen er auf den Docks im Hafen von Brooklyn gearbeitet hatte, fast völlig abhandengekommen war.
Er hielt dem Mann die Scheine hin.
Dieser schüttelte den Kopf. „Dieses Pferd ist zweihundert Dollar wert.“
Cullen schaute ihn an. „Mag sein. Trotzdem bezahle ich nur hundertfünfzig. Denn das ist der Preis, auf den der Schmied und ich uns vor einer Stunde geeinigt haben.“
Ein finsterer Blick trat in die Augen des Mannes. „Dixon hat es sich anders überlegt. Wahrscheinlich hat er beschlossen, dass er dieses Pferd nicht zu diesem Preis verkaufen will. Wenigstens nicht an dich.“
Aus dem Augenwinkel heraus bemerkte Cullen den Schmied, der vorsichtig um den Türrahmen spähte. Schnell begriff er, worum es hier ging.
Er war erst seit zwei Tagen in Nashville, hatte aber bereits den alles andere als freundlichen Empfang erlebt, mit dem die meisten Südstaatler hier Menschen aus seiner Heimat begegneten. Und falls ihm das wie durch ein Wunder entgangen wäre, sprachen die unzähligen Schilder „Aushilfe gesucht! Iren unerwünscht“, die an fast jedem Laden und jeder Werkstatt hingen, eine eindeutige Sprache.
Anscheinend waren die Geschichten über die Gastfreundschaft der Menschen in diesem Land, die er in Irland gehört hatte, nicht ganz zutreffend. Aber das hier war eine neue Welt, eine freie Welt. Er hatte jedes Recht, hier zu sein. Und er war zu weit gekommen, um jetzt umzukehren.
Cullen betrachtete das Geld in seiner Hand und dann den Mann vor sich. „Wenn das der Fall ist, sollten Sie Dixon sagen, dass aus dem Geschäft nichts wird.“
„Er hat kein Interesse an diesem Geschäft.“
Cullen setzte eine gespielt überraschte Miene auf. „Als er mit mir per Handschlag das Geschäft abschloss, schien er aber schon ein Interesse daran zu haben.“ Mit großer Selbstbeherrschung wandte er den Blick von dem eindrucksvollen Pferd ab, das er nach zwei Tagen Suche in Nashvilles Mietställen ausfindig gemacht hatte. Ein Percheron, eines von vielen ausgezeichneten Exemplaren dieser Rasse, die er gesehen hatte. Aber mit diesem Tier war kein anderes vergleichbar. Es war ein schwarzer Hengst mit einem Stockmaß von einem Meter neunzig und einem scharfen Blick, der eine große Klugheit und Kraft verriet. Er würde Cullen helfen, seinen Traum zu verwirklichen. Wenigstens hoffte er das.
„Oder vielleicht“, sprach Cullen weiter und fühlte dem Mann auf den Zahn, „zählt bei euch Südstaatlern ein Handschlag ja nichts?“
„Natürlich zählt bei uns ein Handschlag. Aber wir lassen uns nicht gerne übers Ohr hauen.“
„Übers Ohr hauen?“ Cullen lachte hart. „Das ist eine gefährliche Anschuldigung, mein Freund. Besonders aus dem Mund eines Mannes, der sich nicht an eine Geschäftsvereinbarung hält.“
„Ich bin nicht dein Freund. Und wir haben keine Geschäftsvereinbarung. Nicht mit dir. Nicht mit solchen wie dir.“
Wieder reizte es Cullen, seine Fäuste einzusetzen. „Was genau meinen Sie mit ,solchen wie mir‘?“
Der Mann zog abfällig einen Mundwinkel hoch. „In meinen Augen seid ihr auch nicht besser als diese Neger. Der einzige Unterschied ist eure Hautfarbe. Ihr wollt nichts als stehlen und betrügen und euch alles unter den Nagel reißen, was ihr zwischen die Finger bekommt. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Und von dir auch nicht.“
„Wir sind wie die Schwarzen, sagen Sie?“ Cullen atmete hörbar aus und steckte sein Geld wieder ein. „Sie sind also nicht nur blind, sondern auch noch so dumm, wie die Nacht finster ist? Oder glauben Sie wirklich, dass Sie einen Menschen nach der Farbe seiner Haut beurteilen können?“
Cullen gelang es, dem ersten Schlag des Mannes auszuweichen. Und auch dem nervösen Tänzeln des erschrockenen Percherons. Aber der zweite Schlag landete mit voller Wucht in seinem Bauch. Er bekam keine Luft mehr. Dieser Fausthieb erinnerte ihn an seinen älteren Bruder, nur dass Ethan doppelt so kräftig zugeschlagen hatte.
Cullen war atemlos, aber er hielt sich auf den Beinen und schaffte es, seine Faust zielgenau einzusetzen. Der Mann begann zu wanken – Ethan wäre so stolz auf ihn! – und eine Blutspur lief über sein Kinn. Er blinzelte, so als wäre er von Cullens Schlagkraft überrascht.
Auf der Straße verlangsamten die Passanten ihre Schritte, um ihnen gaffend zuzusehen, darunter auch Kinder. Ein kleines Mädchen starrte die Männer mit entsetzter Miene und großen Augen an. Cullen, dessen Faust immer noch vor Schmerz brannte, verlor sofort die Lust an der Schlägerei. Er sah die Chance, den Streit schnell zu beenden und einem dieser hirnlosen Südstaatler ein wenig Vernunft einzubläuen.
Ein kräftiger rechter Haken, blitzschnell und mit voller Wucht – genau, wie Ethan es ihn gelehrt hatte – genügte, und dieser Koloss von einem Mann landete mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden.
Cullen entdeckte den Schmied, der weiter in den Schatten des Stalles zurückwich. „Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu streiten, Dixon“, rief Cullen und lockerte seine Faust. „Aber ich will dieses Pferd haben. Und zwar zu dem Preis, den wir per Handschlag vereinbart haben. Ein Mann, ein Wort. Wenn das nicht mehr gilt“, sagte er mehr zu sich selbst als zum Schmied, „gilt gar nichts mehr.“ Er atmete tief ein und der Schmerz in seiner Seite verriet ihm, dass er morgen beim Aufwachen einen ordentlichen Bluterguss hätte. Er sah wieder nach dem Schmied
„Also, was ist jetzt? Kommen Sie heraus? Oder soll ich zu Ihnen hineinkommen?“
Der Schmied, ein klein gewachsener, stämmiger Mann, kam schneller herausgelaufen, als ihm Cullen angesichts seiner Figur zugetraut hätte. „Das war nicht meine Idee, McGrath. Da-Das …“, stammelte er und warf einen Blick auf seinen Freund, der das Bewusstsein immer noch nicht wiedererlangt hatte. „Das müssen Sie wissen.“
„Ich weiß nur, dass Sie und ich uns die Hand gegeben haben.“ Cullen zog die Geldscheine wieder aus der Tasche. „In meinen Augen heißt das, dass wir im Geschäft sind. Wie sehen Sie das?“
Dixon zögerte. Sein Blick wanderte nervös zuerst zu seinem Freund und dann nach links und rechts die Straße hinauf und hi-
nunter. Schließlich nahm er schnell das Geld und steckte es in seine schmutzige Schürze. „Das Pferd gehört Ihnen. Aber lassen Sie sich hier nicht wieder blicken.“ Sein Blick wanderte zum zweiten Mal an Cullen vorbei. „Ich werde Ihnen nichts mehr verkaufen.“
Cullen schaute hinter sich, um zu erfahren, was es dort Interessantes zu sehen gab. Aber er konnte nichts Auffälliges entdecken. Selbst die neugierigen Zuschauer waren weitergegangen. „Und warum wollen Sie mir nichts mehr verkaufen, Dixon? Mein Geld ist genauso viel wert wie das von jedem anderen.“
„Es geht nicht um Ihr Geld.“
„Wenn das so ist, warum wollen Sie dann nicht …?“
„Weil Sie, wenn Sie sich ein solches Pferd kaufen …“, der Schmied deutete zu dem Percheron, „… damit signalisieren, dass Sie hierbleiben wollen, dass Sie sich ein Stück Land kaufen und vielleicht eine Farm aufbauen wollen.“
„Na und?“ Cullen zuckte die Achseln. „Selbst wenn ich so etwas vorhaben sollte, geht das niemanden etwas an. Was ich tue, ist meine Sache.“
Dixon sah ihn schnaubend an. „Da irren Sie sich, Ire. Sie sind jetzt im Süden, mein Junge. Hier gilt das nicht. Nicht für mich und schon gar nicht für Leute wie Sie. Jetzt nehmen Sie das Pferd und verschwinden Sie, bevor ich es mir anders überlege. Und falls irgendjemand fragt …“ Dixon ging zu seinem Freund, der endlich wieder zu sich kam, um ihm auf die Beine zu helfen. „Von mir haben Sie das Pferd nicht gekauft.“
Diese Warnung gefiel Cullen überhaupt nicht. Sein Missmut wurde durch die trüben Aussichten, was künftige Geschäfte in dieser Stadt betraf, noch verschlimmert. Aber Cullen hatte gelernt, wie wichtig das richtige Timing war – sowohl bei körperlichen Ausei-
nandersetzungen als auch sonst im Leben. Deshalb kam er der Aufforderung des Mannes nach, nahm die Zügel des Percherons und führte sein neu erworbenes Pferd auf die Straße. Dazu war einige Überredungskunst nötig, und er fügte schnell „eigensinnig“ zu den bewundernswerten Eigenschaften des Tieres hinzu.
Er schritt auf eine Sattlerei zu, an der er zuvor vorbeigekommen war, und hoffte, dass der Besitzer dieses Geschäftes sich als weniger engstirnig erweisen würde als die anderen.
Eine ähnliche Hoffnung hegte er auch in Bezug auf mindestens einen Landbesitzer dieser Gegend, obwohl ihn seine Erfahrungen bis jetzt das Gegenteil gelehrt hatten. Auf jeder Farm, die er gestern aufgesucht hatte, um sich nach zum Verkauf stehendem Land zu erkundigen, hatte er die gleiche Antwort erhalten: Iren brauchten gar nicht erst zu fragen! Er fragte trotzdem. Seine Entschlossenheit, sich hier anzusiedeln, ließ ihm keine andere Wahl.
Aber dennoch stand er immer noch mit leeren Händen da, war zweimal sogar mit angelegtem Gewehr vom Hof gejagt worden und hatte sich beschimpfen lassen müssen, er würde unbefugt Privateigentum betreten. Er stieß ein frustriertes Seufzen aus.
In seinen Taschen hatte er die gleiche Währung wie die anderen, aber offenbar war den Leuten sein Geld nicht gut genug. Wenigstens brauchte er keinen Kredit aufzunehmen. Leuten wie ihm, wie Dixon es formuliert hatte, würde keine Bank einen Kredit geben. Aber er ließ sich dadurch nicht von seinem Ziel abbringen. Cullen hatte genug Geld gespart, um eine der kleineren Farmen, die in der Zeitung aufgelistet waren, zu kaufen. Er müsste nur jemanden finden, der bereit war, sie an ihn zu veräußern.
Mehrere Farmen würden innerhalb der nächsten zwei Wochen sogar zwangsversteigert werden. Aber sein Besuch im Gericht gestern Morgen hatte ihn gelehrt, dass bei der Versteigerung das Gebot eines Iren nicht akzeptiert werden würde. Nein, er müsste jemanden finden, der bereit wäre, direkt an ihn zu verkaufen. Auch wenn das im Moment fast unmöglich schien.
Aber vielleicht ließe sich einer der Grundbesitzer, dem die Zwangsversteigerung drohte, überreden, sein Land zu einem guten Preis an ihn zu verkaufen. Er musste lediglich verzweifelt genug sein.
Cullen verlangsamte seine Schritte und seine Aufmerksamkeit wurde auf die lauten Anfeuerungsrufe in der Ferne und ein anderes Geräusch gelenkt, das er immer und überall erkennen würde.
Das unverkennbare, rhythmische Poltern von Pferdehufen. Wie von unsichtbarer Hand geleitet, wanderte sein Blick die Straße hinab zu einem Feld am anderen Ende. Als er das riesige Spruchband erblickte, das über den Eingang gespannt war, wurden Erinnerungen in ihm wach. Mitten auf der Straße blieb er stehen.
BURNS-ISLAND-RENNBAHN verkündete das Spruchband. Darunter war mit kleineren Buchstaben NASHVILLE-VOLL-
BLUT-VEREINIGUNG zu lesen.
Allein schon das Lesen dieser Worte weckte in ihm den starken Wunsch, sich umzudrehen und wegzulaufen, solange er noch konnte. Doch gleichzeitig lockte ihn die Sehnsucht, etwas Vertrautes zu erleben, näher zu kommen. Aber er war klug genug, diesem Drängen nicht nachzugeben. Er hatte doch beschlossen, davor zu fliehen. Allein aus diesem Grund hatte er England verlassen und war nach Amerika gekommen, um hier ein neues Leben anzufangen.
In diesem Moment regte sich eine Frage in ihm, die weder neu noch angenehm war, aber trotzdem hätte er gerne eine Antwort darauf gewusst. War das, was bei der Überfahrt über den Atlantik passiert war, seine Strafe für das gewesen, was er in London getan hatte – und für das, was er nicht getan hatte? Hatte Gott ihm sein Vergehen heimgezahlt?
Wenn das der Fall sein sollte, wäre Gott grausamer, als Cullen ihn sich immer vorgestellt hatte. Konnte der Himmel denn nicht sehen, dass er keine andere Möglichkeit gehabt hatte?
Cullens Griff um die Zügel verstärkte sich. Wenn er mit der Wahrheit herausgerückt wäre, hätte das nichts geändert. Die Leute hatten ihre Entscheidung schon gefällt gehabt. Ganz ähnlich, wie ihn die Menschen hier in dieser Stadt verurteilten, sobald er nur den Mund aufmachte.
Er hatte sich seiner Herkunft nie geschämt und er schämte sich auch jetzt nicht dafür, Ire zu sein. Aber er schämte sich, dass er Gott so viele Jahre lang für einen guten Vater gehalten hatte, wie er ihm von seinem Großvater beschrieben worden war. Doch offenbar hatte Gott eher die Charakterzüge seines eigenen Vaters und war nicht der gerechte und barmherzige Schöpfer, dem Großvater Ian mit einer solchen Hingabe und Liebe nachgefolgt war.
Vom anderen Ende der Straße her schwollen die Anfeuerungsrufe zu größerer Lautstärke an und Cullen spürte einen Durst in sich aufsteigen, der dringend gestillt werden wollte. Aber dieser Teil seines Lebens war tot und für immer begraben. Genauso wie seine geliebte Moira und seine kleine Katie.
Ein scharfer Schmerz durchbohrte ihn und schnürte ihm die Kehle zu.
Wenn er an jenem Tag sein Leben für ihres hätte geben können, hätte er es getan. Er schluckte schwer. Aber Gott hatte seine Bitten nicht erhört. Weder in jenen frühen Morgenstunden noch in den dunklen, leeren Stunden, die nach jener Nacht gekommen waren. Der Nacht, in der das kostbare Leben, das er in den Armen gehalten hatte, in die Ewigkeit weitergewandert war. Mit schmerzerfülltem Herzen hatte Cullen den Himmel um Hilfe angefleht. Aber Gott hatte sich taub gestellt.
Es erschien ihm wie eine Ewigkeit, seit er das letzte Mal zur Messe gegangen war. An einem seiner ersten Abende in Brooklyn war er zufällig an einer katholischen Kirche vorbeigekommen, hatte die bekannten Gebete gehört und sich hineingewagt, obwohl er vorher schon geahnt hatte, dass es vergeblich wäre. Er hatte in der Kirchenbank gesessen, zur Gestalt des gekreuzigten Christus hinaufgesehen und Gott gebeten – nein, angefleht –, ihm zu sagen, warum das alles passiert war. Er hatte ihn gebeten, ihm zu zeigen, wohin er gehen solle und ihm zu sagen, was er als Nächstes tun solle.
Aber er hatte keine Stimme gehört. Kein Flüstern, nicht einmal einen Windhauch hatte der Himmel für ihn übrig gehabt. Deshalb hatte er die Kirche verlassen und sich geschworen, nie wieder eine zu betreten. Gott hatte beschlossen zu schweigen? Na schön! Dann würde Cullen eben auch schweigen.
Der Percheron wurde unruhig und scharrte auf dem Boden.
„Ruhig, Junge“, flüsterte Cullen und streichelte das Tier. Falls er in dieser Stadt oder irgendwo anders eine Hoffnung auf eine Zukunft haben wollte, musste er sein Schicksal in seine eigene Hand nehmen. Seine Vergangenheit musste begraben bleiben.
Aber war der Ozean weit genug, um ihn von der Last seiner Sünden zu trennen? Einer der Männer, denen Ethan unrecht getan hatte, war ein Amerikaner gewesen. Und Cullen hatte gehört, dass der Skandal auch hierzulande in den Zeitungen zu lesen gewesen war. Das stellte keine Überraschung dar, wenn man bedachte, welches Pferd daran beteiligt gewesen war und wie viel Geld die ganze Angelegenheit den amerikanischen Geschäftsmann gekostet hatte. Cullen atmete schwer aus. Die Dämonen seiner Vergangenheit – und die Dämonen, die Ethan wahrscheinlich plagten, wo auch immer sich sein Bruder gerade aufhielt – waren vielleicht endlich müde geworden und hatten es aufgegeben, ihn zu verfolgen. Falls dem nicht so war, würden sie Cullen, wenn sie ihn erwischten, bestimmt mit Haut und Haaren fressen.
Entschlossen, sich nicht von ihnen erwischen zu lassen, setzte er seinen Weg in die entgegengesetzte Richtung fort und steuerte auf die Sattlerei zu. Er war viele Tausend Meilen von der Londoner Vollblut-Vereinigung entfernt und hatte die feste Absicht, es auch dabei zu belassen. Er wollte sich von Vollblutpferden – und dieser Pferderennbahn – so weit wie möglich fernhalten.
Er wusste auch genau, wie er das anstellen musste. Er würde sich auf irgendeine kleine Farm außerhalb der Stadt zurückziehen, in eine andere Welt. Allein. Das war sein Ziel. Vielleicht würde er dann den Frieden finden, den er suchte.
In der Sattlerei schaute er sich die verschiedenen Sättel an und entschied sich für einen mit einer sauberen, aber schlichten Lederarbeit. Die Sättel, die zwar kunstvoller aussahen, aber nicht so gut verarbeitet waren, ließ er links liegen. Sein Blick fiel auf einen eleganten Sattel, den sicher Ethan gewählt hätte, wenn er an seiner Stelle gewesen wäre.
Cullen beschloss zu zahlen, ging zur Verkaufstheke und nickte der jungen Frau, die ihn aufmerksam beobachtete, höflich zu.
„Guten Tag, Sir“, sagte sie leise und lächelte ihn mit leuchtenden Augen an. „Brauchen Sie vielleicht noch etwas anderes?“
Cullen ignorierte bewusst die Einladung in ihrer Stimme und schüttelte den Kopf. „Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche, Miss. Aber trotzdem vielen Dank.“
Als hätte er eine Kerze ausgeblasen, verschwand das Leuchten aus den Augen der Frau. Sie schaute ihn an, als wäre ihm plötzlich ein zweiter Kopf gewachsen, den sie weitaus weniger attraktiv fand als den ersten.
Während sie schweigend und mit stoischer Miene seine Rechnung erstellte, dachte Cullen an den Abend mit Ethan in einem englischen Pub zurück, in dem ein Barmädchen ganz ähnlich reagiert hatte.
Cullen, du armer Kerl! Ethan hatte lachend sein Bierglas an seinen Mund geführt. Wenn du nach unserem Vater geraten würdest wie ich und dir anzusehen wäre, dass du Ire bist, würde dir so etwas nicht passieren. Aber so … Ethan hatte kräftig gerülpst … kannst du dich bei unserer Mutter für deine hellgrünen Augen und die dunklen Locken bedanken, die alle Damen so reizvoll finden … bis du den Mund aufmachst! Er hatte wieder lauthals gelacht.
Cullen musste in Erinnerung daran lächeln. Offenbar hatten die Südstaatenfrauen die gleiche Meinung über irische Männer wie englische Barmädchen. Im Laufe der Jahre hatte Ethan ihn gnadenlos damit aufgezogen, dass er nicht wie ein Ire aussehe. Aber abgesehen von ihrer Haarfarbe hätten Ethan und er als Zwillinge durchgehen können. Ja, Ethan war zwar ein wenig kräftiger gebaut, aber ihre Gesichtszüge wiesen sie überdeutlich als Brüder aus.
Eine halbe Stunde später hatte Cullen das Pferd gesattelt und wollte gerade weiterreiten, als er spürte, dass jemand hinter ihm stand. Er wusste sofort, wer es war, und wünschte jetzt, er hätte den Kampf zu Ende geführt, solange er dazu Gelegenheit gehabt hatte. Mit geballter Faust wirbelte er herum.
Aber hinter ihm stand nicht der Mann, den er erwartet hatte.
Nashville, 1869. Maggie Linden ist eine passionierte Reiterin und trainiert ihr Pferd Bourbon Belle für ein großes Rennen. Doch als der Farm ihres Vaters die Zwangsversteigerung droht, scheinen ihre Träume zu zerplatzen. Unterdessen versucht der attraktive, etwas kantige irische Einwanderer Cullen McGrath in Tennessee Fuß zu fassen. Überall stößt er auf verschlossene Türen, bis Maggies Vater ihm ein ungewöhnliches Angebot macht …
Eine spannende, manchmal zum Weinen und manchmal zum Lachen bringende Geschichte von Menschen, die gegen alle Konventionen ihren Überzeugungen und Träumen folgen.
Erstes Kapitel
Kapitel 1
Nashville, Tennessee
4. Mai 1869
„Ruhig, Mädchen“, flüsterte Maggie, während sie die Lederzügel fest in den Händen hielt und von der Felswand hinabschaute. Das Stimmengewirr der Zuschauer auf der Rennbahn unter ihr wehte im kühlen Morgenwind zu ihr herauf. Sie beugte sich vor, um dem Vollblutpferd den Hals zu streicheln. „Warte nur“, flüsterte sie beruhigend und spürte die gespannte Vorfreude, die in der Luft lag. „Unser Tag wird kommen.“ Noch während sie das sagte, schlug ihr eigener Puls ein wenig höher.
Bourbon Belle scharrte auf der Erde und Maggie spürte, dass die Stute mit jeder Sekunde ungeduldiger wurde.
Der Startschuss ertönte. Die Pferde auf der Rennbahn unter ihnen stürmten genauso los wie Bourbon Belle über ihnen auf dem Felsplateau. Eine unbändige Freude schoss durch Maggies Adern.
Belle erwachte zum Leben. Maggie überließ dem Pferd die Führung und erlaubte der Stute, jedem Instinkt zu folgen, den ihr der muskulöse Körper eingab – dem unbändigen Instinkt zu laufen.
Belles Hufe polterten über den glatten Feldweg und Maggie ahnte, dass Willie dieses Gefühl erlebte, wenn er mit Belle unten auf der Rennbahn mit den anderen um den Sieg ritt. Allerdings war der Junge nur halb so schwer wie Maggie, sodass er und Belle fast über den Boden flogen. So würde es auch wieder beim Rennen in ein paar Tagen sein.
Die Strecke war nur zwei Kilometer lang und das Rennen dauerte kaum zwei Minuten. Das Hämmern ihres Herzens war Maggies Zeitmesser, als Belle um die vertraute Kurve auf dem Weg bog und die kräftig ausholenden Beine der Stute die Strecke im Nu zurücklegten.
Maggie beugte sich vor, wie sie es mit Willie immer eintrainierte. Sie fühlte, wie der Wind die Nadeln aus ihren Haaren zerrte, und genoss die Freiheit, die man nur bei einem solchen Ritt erlebte. Obwohl sie wusste, dass dieser Friede bestenfalls von kurzer Dauer sein würde, kostete sie ihn in vollen Zügen aus.
Belles Hufe polterten und Maggie trieb sie an, während die letzte Wegstrecke vor ihnen auftauchte. In diesem Moment stiegen unterhalb von ihnen Jubelrufe von der Rennbahn auf. Als Maggie kurz den Kopf drehte, sah sie ein Vollblutpferd, das in diesem Moment die Ziellinie passierte. Belle galoppierte mit voller Kraft weiter und verlangsamte ihr Tempo erst, als Maggie an den Zügeln zog.
Atemlos hielt Maggie an und genoss den süßen Duft des Grases in vollen Zügen. Sie beugte sich vor, um Belle zwischen den Ohren zu streicheln. „Gut gemacht, Mädchen.“ Maggie atmete tief ein. „Dass wir nicht noch schneller waren, lag allein an mir.“
Belle wieherte, als wolle sie ihr recht geben, und Maggie lächelte.
Die Siegesprämie bei dem bevorstehenden Rennen – falls Willie und Belle das Rennen gewannen, wovon Maggie felsenfest überzeugt war – würde nicht annähernd ausreichen, um die ausstehenden Steuerschulden für Linden Downs zu zahlen. Aber sie hoffte, dass das Geld genügen würde, um das Grundsteueramt etwas milde zu stimmen. Wieder einmal.
Belle hatte bereits die letzten fünf Ausscheidungsrennen gewonnen und angesichts der vielen Veranstaltungen auf der Burns-Island-Rennbahn rechnete Maggie in den nächsten Monaten mit einer relativ sicheren Einnahmequelle. Aber Maggies großes Ziel war das Peyton Stakes im Herbst, das größte Pferderennen im ganzen Land mit der höchsten Siegprämie der Geschichte. Dieses Rennen würde hier in Nashville ausgetragen werden. Die Frage war nur, ob Linden Downs sich bis dahin über Wasser halten konnte. Ihre Bourbon Belle, die dreijährige Stute, die sie schon als Fohlen aufgezogen hatte, würde auch dieses Rennen gewinnen – die Wettkampfzeiten der Stute bewiesen das ohne jeden Zweifel. Maggie hoffte nur, dass keine unvorhergesehene Konkurrenz antreten würde. Trotz ihres Vertrauens in die Fähigkeiten ihrer Stute empfand sie die nächsten Monate wie eine unüberwindliche Hürde. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie und ihr Vater, obwohl sie so lange durchgehalten hatten, ihr Zuhause in letzter Minute doch noch verlieren könnten.
Maggie stieg ab und war dankbar für die Gelegenheit, sich die Beine zu vertreten und Belle abkühlen zu lassen, bevor sie nach Hause ritten. Aber als die Minuten verstrichen und sich die Aufregung wegen des Rennens auf der Rennbahn unter ihnen legte, wurde Maggie die Tragweite ihrer Situation wieder mit voller Wucht bewusst.
Wie war es so weit gekommen? Zu diesem schmerzlichen Niedergang von etwas, das sie mit so großer Anstrengung hatten zusammenhalten wollen? Aber sie weigerte sich, die Verzweiflung siegen zu lassen. Sie würde nicht aufgeben.
Sie hatte einen Jockey, der in nur vier Tagen zum Rennen antreten würde.
Sie könnten es schaffen. Mit Belle und mit Linden Downs. Eine andere Wahl blieb ihr nicht. Ihr Vater war so lange ihr Schutz und ihre Zuflucht gewesen – nun war es ihre Aufgabe, für ihn zu sorgen.
Maggie hob ihren Beutel und ihr Gewehr auf, das sie vor dem Rennen abgelegt hatte. Den Beutel stopfte sie in die Satteltasche und ihr Gewehr schob sie in das Halfter, das daran befestigt war. Pferderennen und Schießen an einem einzigen Tag – das empfand sie als großen Segen … aber irgendwie schien dieses Wort für diese beiden Tätigkeiten nicht ganz zu passen.
Sie schwang sich wieder in den Sattel und lenkte Belle nach Hause. Schnell stellte sie fest, dass die Stute keine Lust hatte, gemütlich zu traben oder nur in einem kurzen Galopp zu laufen. Das Voll-
blutpferd wollte das tun, was es am besten konnte.
Maggie ließ ihm gerne freien Lauf.
Cullen McGrath kniete am Flussufer und blickte in das trübe Wasser des Cumberland River. Doch seine Augen sahen nur die dunklen Schatten der salzigen Meerestiefen, die seine Welt verschlungen hatten. Er war eigentlich nie ein Mann gewesen, der seine Entscheidungen infrage stellte. Doch seit er vor einem Jahr zum ersten Mal seine schmutzigen Stiefel auf den Boden dieses Landes gesetzt hatte, wurde er öfter von Zweifeln geplagt.
Auch das tiefe Bedauern hatte sich als ein grausamer Begleiter seiner Gedanken erwiesen. Aber einer Sache war er sich sicher:
„Ich halte das Versprechen, das ich dir gegeben habe“, flüsterte er in die feuchte Morgenluft hinein. „Koste es, was es wolle.“ Wurden Versprechen, die auf dieser Erde laut ausgesprochen wurden, in der nächsten Welt gehört? Er hoffte es. Wenigstens in diesem Moment. Sein Großvater, der oft von solchen Dingen gesprochen hatte, hatte ihm das versichert.
Ja, Cullen, mein Junge. Nur Narren glauben, dass dieses Leben alles wäre. Die Welt, die nach diesem Leben kommt, ist viel größer. Und das Geheimnis für ein erfülltes Leben auf dieser Erde liegt darin, dass wir den Blick auf das Leben danach richten. Vergiss nie, dass du …
„Hey! Du da drüben! Das Pferd ist bereit.“
Cullen verzog das Gesicht, als er so unsanft aus seinen Gedanken gerissen wurde, obwohl der vertraute irische Akzent seines Großvaters noch wie der Morgennebel seine Gedanken überlagerte. Als Junge hatte man ihm gesagt, dass er genauso spreche wie sein Großvater. Diesen Vergleich hatte er aber erst in den letzten Jahren richtig zu schätzen gelernt.
Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf, doch als er sich umdrehen wollte, fiel sein Blick auf eine Bewegung auf der anderen Seite des Flusses. Ein Pferd schoss mit seinem Reiter in rasender Geschwindigkeit vorbei. Schnell wie ein Blitz. Er kniff die Augen zusammen. Das konnte doch nicht sein!
Da wehte ein Rock hinter dem Reiter her. Es schien ein zierliches Mädchen zu sein – oder war es eine Frau? Das war aus dieser Entfernung heraus nur schwer zu sagen. Sie ritt jedenfalls mit einer Freiheit und Leidenschaft, die ihn wehmütig an ein anderes Leben erinnerte. Und sie ritt auch noch in einem Männersattel! Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Ein solches Tempo und eine solche Anmut hatte er bei keinem Pferd mehr gesehen, seit Bonnie Scotland damals wie der Wind …
„Hey! Hörst du mir überhaupt zu, Junge?“
Junge? Missmutig drehte sich Cullen um und richtete seinen Blick auf den Koloss von einem Mann, der mit den Zügeln in der Hand wartend dastand.
Es war nicht der Schmied, der gleichzeitig Eigentümer des Mietstalls war. Er hatte Cullens Angebot vor einer Stunde angenommen – wenn auch nur zähneknirschend, wie er aus dem Widerstreben des Schmieds, das Geschäft per Handschlag festzumachen, schloss. Aber diesen Mann hatte Cullen auch schon gesehen. Er war ein paar Jahre jünger als er selbst und sah ziemlich eingebildet aus. Er war kurze Zeit, nachdem der Schmied den Verkauf mit Cullen festgemacht hatte, in den Stall gekommen und hatte ihr Gespräch verfolgt.
Cullen ging auf den Mann zu. Die Angriffslust, die dieser ausstrahlte, war fast zum Greifen nahe. Verachtung lag in seinem Blick. Früher hätte er diesem Mann einen Fausthieb verpasst, wenn er ihn nur schief angesehen hätte. Aber Cullen bezweifelte, dass ein einziger Schlag einen Mann von dieser Statur zu Boden werfen würde.
Da er ihm an Kraft aber in nichts nachzustehen schien, schätzte Cullen, dass ein gut gezielter Fausthieb ihn zumindest ins Wanken bringen könnte. Wenn er an die Wut dachte, die sich in den letzten Monaten in ihm aufgestaut hatte, würde es sich gut anfühlen, diesen Typen seine Faust spüren zu lassen, damit ihm sein eingebildetes, hämisches Grinsen verginge.
Aber er wollte das Geschäft, das er abgeschlossen hatte, nicht verderben und erwiderte deshalb nur furchtlos den direkten Blick des Mannes, statt alten Instinkten nachzugeben. Er holte eine Packung Geldscheine aus seiner Hemdtasche und zählte sie mit einer Höflichkeit ab, die ihm in den Monaten, in denen er auf den Docks im Hafen von Brooklyn gearbeitet hatte, fast völlig abhandengekommen war.
Er hielt dem Mann die Scheine hin.
Dieser schüttelte den Kopf. „Dieses Pferd ist zweihundert Dollar wert.“
Cullen schaute ihn an. „Mag sein. Trotzdem bezahle ich nur hundertfünfzig. Denn das ist der Preis, auf den der Schmied und ich uns vor einer Stunde geeinigt haben.“
Ein finsterer Blick trat in die Augen des Mannes. „Dixon hat es sich anders überlegt. Wahrscheinlich hat er beschlossen, dass er dieses Pferd nicht zu diesem Preis verkaufen will. Wenigstens nicht an dich.“
Aus dem Augenwinkel heraus bemerkte Cullen den Schmied, der vorsichtig um den Türrahmen spähte. Schnell begriff er, worum es hier ging.
Er war erst seit zwei Tagen in Nashville, hatte aber bereits den alles andere als freundlichen Empfang erlebt, mit dem die meisten Südstaatler hier Menschen aus seiner Heimat begegneten. Und falls ihm das wie durch ein Wunder entgangen wäre, sprachen die unzähligen Schilder „Aushilfe gesucht! Iren unerwünscht“, die an fast jedem Laden und jeder Werkstatt hingen, eine eindeutige Sprache.
Anscheinend waren die Geschichten über die Gastfreundschaft der Menschen in diesem Land, die er in Irland gehört hatte, nicht ganz zutreffend. Aber das hier war eine neue Welt, eine freie Welt. Er hatte jedes Recht, hier zu sein. Und er war zu weit gekommen, um jetzt umzukehren.
Cullen betrachtete das Geld in seiner Hand und dann den Mann vor sich. „Wenn das der Fall ist, sollten Sie Dixon sagen, dass aus dem Geschäft nichts wird.“
„Er hat kein Interesse an diesem Geschäft.“
Cullen setzte eine gespielt überraschte Miene auf. „Als er mit mir per Handschlag das Geschäft abschloss, schien er aber schon ein Interesse daran zu haben.“ Mit großer Selbstbeherrschung wandte er den Blick von dem eindrucksvollen Pferd ab, das er nach zwei Tagen Suche in Nashvilles Mietställen ausfindig gemacht hatte. Ein Percheron, eines von vielen ausgezeichneten Exemplaren dieser Rasse, die er gesehen hatte. Aber mit diesem Tier war kein anderes vergleichbar. Es war ein schwarzer Hengst mit einem Stockmaß von einem Meter neunzig und einem scharfen Blick, der eine große Klugheit und Kraft verriet. Er würde Cullen helfen, seinen Traum zu verwirklichen. Wenigstens hoffte er das.
„Oder vielleicht“, sprach Cullen weiter und fühlte dem Mann auf den Zahn, „zählt bei euch Südstaatlern ein Handschlag ja nichts?“
„Natürlich zählt bei uns ein Handschlag. Aber wir lassen uns nicht gerne übers Ohr hauen.“
„Übers Ohr hauen?“ Cullen lachte hart. „Das ist eine gefährliche Anschuldigung, mein Freund. Besonders aus dem Mund eines Mannes, der sich nicht an eine Geschäftsvereinbarung hält.“
„Ich bin nicht dein Freund. Und wir haben keine Geschäftsvereinbarung. Nicht mit dir. Nicht mit solchen wie dir.“
Wieder reizte es Cullen, seine Fäuste einzusetzen. „Was genau meinen Sie mit ,solchen wie mir‘?“
Der Mann zog abfällig einen Mundwinkel hoch. „In meinen Augen seid ihr auch nicht besser als diese Neger. Der einzige Unterschied ist eure Hautfarbe. Ihr wollt nichts als stehlen und betrügen und euch alles unter den Nagel reißen, was ihr zwischen die Finger bekommt. Aber das lassen wir uns nicht gefallen. Und von dir auch nicht.“
„Wir sind wie die Schwarzen, sagen Sie?“ Cullen atmete hörbar aus und steckte sein Geld wieder ein. „Sie sind also nicht nur blind, sondern auch noch so dumm, wie die Nacht finster ist? Oder glauben Sie wirklich, dass Sie einen Menschen nach der Farbe seiner Haut beurteilen können?“
Cullen gelang es, dem ersten Schlag des Mannes auszuweichen. Und auch dem nervösen Tänzeln des erschrockenen Percherons. Aber der zweite Schlag landete mit voller Wucht in seinem Bauch. Er bekam keine Luft mehr. Dieser Fausthieb erinnerte ihn an seinen älteren Bruder, nur dass Ethan doppelt so kräftig zugeschlagen hatte.
Cullen war atemlos, aber er hielt sich auf den Beinen und schaffte es, seine Faust zielgenau einzusetzen. Der Mann begann zu wanken – Ethan wäre so stolz auf ihn! – und eine Blutspur lief über sein Kinn. Er blinzelte, so als wäre er von Cullens Schlagkraft überrascht.
Auf der Straße verlangsamten die Passanten ihre Schritte, um ihnen gaffend zuzusehen, darunter auch Kinder. Ein kleines Mädchen starrte die Männer mit entsetzter Miene und großen Augen an. Cullen, dessen Faust immer noch vor Schmerz brannte, verlor sofort die Lust an der Schlägerei. Er sah die Chance, den Streit schnell zu beenden und einem dieser hirnlosen Südstaatler ein wenig Vernunft einzubläuen.
Ein kräftiger rechter Haken, blitzschnell und mit voller Wucht – genau, wie Ethan es ihn gelehrt hatte – genügte, und dieser Koloss von einem Mann landete mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden.
Cullen entdeckte den Schmied, der weiter in den Schatten des Stalles zurückwich. „Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu streiten, Dixon“, rief Cullen und lockerte seine Faust. „Aber ich will dieses Pferd haben. Und zwar zu dem Preis, den wir per Handschlag vereinbart haben. Ein Mann, ein Wort. Wenn das nicht mehr gilt“, sagte er mehr zu sich selbst als zum Schmied, „gilt gar nichts mehr.“ Er atmete tief ein und der Schmerz in seiner Seite verriet ihm, dass er morgen beim Aufwachen einen ordentlichen Bluterguss hätte. Er sah wieder nach dem Schmied
„Also, was ist jetzt? Kommen Sie heraus? Oder soll ich zu Ihnen hineinkommen?“
Der Schmied, ein klein gewachsener, stämmiger Mann, kam schneller herausgelaufen, als ihm Cullen angesichts seiner Figur zugetraut hätte. „Das war nicht meine Idee, McGrath. Da-Das …“, stammelte er und warf einen Blick auf seinen Freund, der das Bewusstsein immer noch nicht wiedererlangt hatte. „Das müssen Sie wissen.“
„Ich weiß nur, dass Sie und ich uns die Hand gegeben haben.“ Cullen zog die Geldscheine wieder aus der Tasche. „In meinen Augen heißt das, dass wir im Geschäft sind. Wie sehen Sie das?“
Dixon zögerte. Sein Blick wanderte nervös zuerst zu seinem Freund und dann nach links und rechts die Straße hinauf und hi-
nunter. Schließlich nahm er schnell das Geld und steckte es in seine schmutzige Schürze. „Das Pferd gehört Ihnen. Aber lassen Sie sich hier nicht wieder blicken.“ Sein Blick wanderte zum zweiten Mal an Cullen vorbei. „Ich werde Ihnen nichts mehr verkaufen.“
Cullen schaute hinter sich, um zu erfahren, was es dort Interessantes zu sehen gab. Aber er konnte nichts Auffälliges entdecken. Selbst die neugierigen Zuschauer waren weitergegangen. „Und warum wollen Sie mir nichts mehr verkaufen, Dixon? Mein Geld ist genauso viel wert wie das von jedem anderen.“
„Es geht nicht um Ihr Geld.“
„Wenn das so ist, warum wollen Sie dann nicht …?“
„Weil Sie, wenn Sie sich ein solches Pferd kaufen …“, der Schmied deutete zu dem Percheron, „… damit signalisieren, dass Sie hierbleiben wollen, dass Sie sich ein Stück Land kaufen und vielleicht eine Farm aufbauen wollen.“
„Na und?“ Cullen zuckte die Achseln. „Selbst wenn ich so etwas vorhaben sollte, geht das niemanden etwas an. Was ich tue, ist meine Sache.“
Dixon sah ihn schnaubend an. „Da irren Sie sich, Ire. Sie sind jetzt im Süden, mein Junge. Hier gilt das nicht. Nicht für mich und schon gar nicht für Leute wie Sie. Jetzt nehmen Sie das Pferd und verschwinden Sie, bevor ich es mir anders überlege. Und falls irgendjemand fragt …“ Dixon ging zu seinem Freund, der endlich wieder zu sich kam, um ihm auf die Beine zu helfen. „Von mir haben Sie das Pferd nicht gekauft.“
Diese Warnung gefiel Cullen überhaupt nicht. Sein Missmut wurde durch die trüben Aussichten, was künftige Geschäfte in dieser Stadt betraf, noch verschlimmert. Aber Cullen hatte gelernt, wie wichtig das richtige Timing war – sowohl bei körperlichen Ausei-
nandersetzungen als auch sonst im Leben. Deshalb kam er der Aufforderung des Mannes nach, nahm die Zügel des Percherons und führte sein neu erworbenes Pferd auf die Straße. Dazu war einige Überredungskunst nötig, und er fügte schnell „eigensinnig“ zu den bewundernswerten Eigenschaften des Tieres hinzu.
Er schritt auf eine Sattlerei zu, an der er zuvor vorbeigekommen war, und hoffte, dass der Besitzer dieses Geschäftes sich als weniger engstirnig erweisen würde als die anderen.
Eine ähnliche Hoffnung hegte er auch in Bezug auf mindestens einen Landbesitzer dieser Gegend, obwohl ihn seine Erfahrungen bis jetzt das Gegenteil gelehrt hatten. Auf jeder Farm, die er gestern aufgesucht hatte, um sich nach zum Verkauf stehendem Land zu erkundigen, hatte er die gleiche Antwort erhalten: Iren brauchten gar nicht erst zu fragen! Er fragte trotzdem. Seine Entschlossenheit, sich hier anzusiedeln, ließ ihm keine andere Wahl.
Aber dennoch stand er immer noch mit leeren Händen da, war zweimal sogar mit angelegtem Gewehr vom Hof gejagt worden und hatte sich beschimpfen lassen müssen, er würde unbefugt Privateigentum betreten. Er stieß ein frustriertes Seufzen aus.
In seinen Taschen hatte er die gleiche Währung wie die anderen, aber offenbar war den Leuten sein Geld nicht gut genug. Wenigstens brauchte er keinen Kredit aufzunehmen. Leuten wie ihm, wie Dixon es formuliert hatte, würde keine Bank einen Kredit geben. Aber er ließ sich dadurch nicht von seinem Ziel abbringen. Cullen hatte genug Geld gespart, um eine der kleineren Farmen, die in der Zeitung aufgelistet waren, zu kaufen. Er müsste nur jemanden finden, der bereit war, sie an ihn zu veräußern.
Mehrere Farmen würden innerhalb der nächsten zwei Wochen sogar zwangsversteigert werden. Aber sein Besuch im Gericht gestern Morgen hatte ihn gelehrt, dass bei der Versteigerung das Gebot eines Iren nicht akzeptiert werden würde. Nein, er müsste jemanden finden, der bereit wäre, direkt an ihn zu verkaufen. Auch wenn das im Moment fast unmöglich schien.
Aber vielleicht ließe sich einer der Grundbesitzer, dem die Zwangsversteigerung drohte, überreden, sein Land zu einem guten Preis an ihn zu verkaufen. Er musste lediglich verzweifelt genug sein.
Cullen verlangsamte seine Schritte und seine Aufmerksamkeit wurde auf die lauten Anfeuerungsrufe in der Ferne und ein anderes Geräusch gelenkt, das er immer und überall erkennen würde.
Das unverkennbare, rhythmische Poltern von Pferdehufen. Wie von unsichtbarer Hand geleitet, wanderte sein Blick die Straße hinab zu einem Feld am anderen Ende. Als er das riesige Spruchband erblickte, das über den Eingang gespannt war, wurden Erinnerungen in ihm wach. Mitten auf der Straße blieb er stehen.
BURNS-ISLAND-RENNBAHN verkündete das Spruchband. Darunter war mit kleineren Buchstaben NASHVILLE-VOLL-
BLUT-VEREINIGUNG zu lesen.
Allein schon das Lesen dieser Worte weckte in ihm den starken Wunsch, sich umzudrehen und wegzulaufen, solange er noch konnte. Doch gleichzeitig lockte ihn die Sehnsucht, etwas Vertrautes zu erleben, näher zu kommen. Aber er war klug genug, diesem Drängen nicht nachzugeben. Er hatte doch beschlossen, davor zu fliehen. Allein aus diesem Grund hatte er England verlassen und war nach Amerika gekommen, um hier ein neues Leben anzufangen.
In diesem Moment regte sich eine Frage in ihm, die weder neu noch angenehm war, aber trotzdem hätte er gerne eine Antwort darauf gewusst. War das, was bei der Überfahrt über den Atlantik passiert war, seine Strafe für das gewesen, was er in London getan hatte – und für das, was er nicht getan hatte? Hatte Gott ihm sein Vergehen heimgezahlt?
Wenn das der Fall sein sollte, wäre Gott grausamer, als Cullen ihn sich immer vorgestellt hatte. Konnte der Himmel denn nicht sehen, dass er keine andere Möglichkeit gehabt hatte?
Cullens Griff um die Zügel verstärkte sich. Wenn er mit der Wahrheit herausgerückt wäre, hätte das nichts geändert. Die Leute hatten ihre Entscheidung schon gefällt gehabt. Ganz ähnlich, wie ihn die Menschen hier in dieser Stadt verurteilten, sobald er nur den Mund aufmachte.
Er hatte sich seiner Herkunft nie geschämt und er schämte sich auch jetzt nicht dafür, Ire zu sein. Aber er schämte sich, dass er Gott so viele Jahre lang für einen guten Vater gehalten hatte, wie er ihm von seinem Großvater beschrieben worden war. Doch offenbar hatte Gott eher die Charakterzüge seines eigenen Vaters und war nicht der gerechte und barmherzige Schöpfer, dem Großvater Ian mit einer solchen Hingabe und Liebe nachgefolgt war.
Vom anderen Ende der Straße her schwollen die Anfeuerungsrufe zu größerer Lautstärke an und Cullen spürte einen Durst in sich aufsteigen, der dringend gestillt werden wollte. Aber dieser Teil seines Lebens war tot und für immer begraben. Genauso wie seine geliebte Moira und seine kleine Katie.
Ein scharfer Schmerz durchbohrte ihn und schnürte ihm die Kehle zu.
Wenn er an jenem Tag sein Leben für ihres hätte geben können, hätte er es getan. Er schluckte schwer. Aber Gott hatte seine Bitten nicht erhört. Weder in jenen frühen Morgenstunden noch in den dunklen, leeren Stunden, die nach jener Nacht gekommen waren. Der Nacht, in der das kostbare Leben, das er in den Armen gehalten hatte, in die Ewigkeit weitergewandert war. Mit schmerzerfülltem Herzen hatte Cullen den Himmel um Hilfe angefleht. Aber Gott hatte sich taub gestellt.
Es erschien ihm wie eine Ewigkeit, seit er das letzte Mal zur Messe gegangen war. An einem seiner ersten Abende in Brooklyn war er zufällig an einer katholischen Kirche vorbeigekommen, hatte die bekannten Gebete gehört und sich hineingewagt, obwohl er vorher schon geahnt hatte, dass es vergeblich wäre. Er hatte in der Kirchenbank gesessen, zur Gestalt des gekreuzigten Christus hinaufgesehen und Gott gebeten – nein, angefleht –, ihm zu sagen, warum das alles passiert war. Er hatte ihn gebeten, ihm zu zeigen, wohin er gehen solle und ihm zu sagen, was er als Nächstes tun solle.
Aber er hatte keine Stimme gehört. Kein Flüstern, nicht einmal einen Windhauch hatte der Himmel für ihn übrig gehabt. Deshalb hatte er die Kirche verlassen und sich geschworen, nie wieder eine zu betreten. Gott hatte beschlossen zu schweigen? Na schön! Dann würde Cullen eben auch schweigen.
Der Percheron wurde unruhig und scharrte auf dem Boden.
„Ruhig, Junge“, flüsterte Cullen und streichelte das Tier. Falls er in dieser Stadt oder irgendwo anders eine Hoffnung auf eine Zukunft haben wollte, musste er sein Schicksal in seine eigene Hand nehmen. Seine Vergangenheit musste begraben bleiben.
Aber war der Ozean weit genug, um ihn von der Last seiner Sünden zu trennen? Einer der Männer, denen Ethan unrecht getan hatte, war ein Amerikaner gewesen. Und Cullen hatte gehört, dass der Skandal auch hierzulande in den Zeitungen zu lesen gewesen war. Das stellte keine Überraschung dar, wenn man bedachte, welches Pferd daran beteiligt gewesen war und wie viel Geld die ganze Angelegenheit den amerikanischen Geschäftsmann gekostet hatte. Cullen atmete schwer aus. Die Dämonen seiner Vergangenheit – und die Dämonen, die Ethan wahrscheinlich plagten, wo auch immer sich sein Bruder gerade aufhielt – waren vielleicht endlich müde geworden und hatten es aufgegeben, ihn zu verfolgen. Falls dem nicht so war, würden sie Cullen, wenn sie ihn erwischten, bestimmt mit Haut und Haaren fressen.
Entschlossen, sich nicht von ihnen erwischen zu lassen, setzte er seinen Weg in die entgegengesetzte Richtung fort und steuerte auf die Sattlerei zu. Er war viele Tausend Meilen von der Londoner Vollblut-Vereinigung entfernt und hatte die feste Absicht, es auch dabei zu belassen. Er wollte sich von Vollblutpferden – und dieser Pferderennbahn – so weit wie möglich fernhalten.
Er wusste auch genau, wie er das anstellen musste. Er würde sich auf irgendeine kleine Farm außerhalb der Stadt zurückziehen, in eine andere Welt. Allein. Das war sein Ziel. Vielleicht würde er dann den Frieden finden, den er suchte.
In der Sattlerei schaute er sich die verschiedenen Sättel an und entschied sich für einen mit einer sauberen, aber schlichten Lederarbeit. Die Sättel, die zwar kunstvoller aussahen, aber nicht so gut verarbeitet waren, ließ er links liegen. Sein Blick fiel auf einen eleganten Sattel, den sicher Ethan gewählt hätte, wenn er an seiner Stelle gewesen wäre.
Cullen beschloss zu zahlen, ging zur Verkaufstheke und nickte der jungen Frau, die ihn aufmerksam beobachtete, höflich zu.
„Guten Tag, Sir“, sagte sie leise und lächelte ihn mit leuchtenden Augen an. „Brauchen Sie vielleicht noch etwas anderes?“
Cullen ignorierte bewusst die Einladung in ihrer Stimme und schüttelte den Kopf. „Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche, Miss. Aber trotzdem vielen Dank.“
Als hätte er eine Kerze ausgeblasen, verschwand das Leuchten aus den Augen der Frau. Sie schaute ihn an, als wäre ihm plötzlich ein zweiter Kopf gewachsen, den sie weitaus weniger attraktiv fand als den ersten.
Während sie schweigend und mit stoischer Miene seine Rechnung erstellte, dachte Cullen an den Abend mit Ethan in einem englischen Pub zurück, in dem ein Barmädchen ganz ähnlich reagiert hatte.
Cullen, du armer Kerl! Ethan hatte lachend sein Bierglas an seinen Mund geführt. Wenn du nach unserem Vater geraten würdest wie ich und dir anzusehen wäre, dass du Ire bist, würde dir so etwas nicht passieren. Aber so … Ethan hatte kräftig gerülpst … kannst du dich bei unserer Mutter für deine hellgrünen Augen und die dunklen Locken bedanken, die alle Damen so reizvoll finden … bis du den Mund aufmachst! Er hatte wieder lauthals gelacht.
Cullen musste in Erinnerung daran lächeln. Offenbar hatten die Südstaatenfrauen die gleiche Meinung über irische Männer wie englische Barmädchen. Im Laufe der Jahre hatte Ethan ihn gnadenlos damit aufgezogen, dass er nicht wie ein Ire aussehe. Aber abgesehen von ihrer Haarfarbe hätten Ethan und er als Zwillinge durchgehen können. Ja, Ethan war zwar ein wenig kräftiger gebaut, aber ihre Gesichtszüge wiesen sie überdeutlich als Brüder aus.
Eine halbe Stunde später hatte Cullen das Pferd gesattelt und wollte gerade weiterreiten, als er spürte, dass jemand hinter ihm stand. Er wusste sofort, wer es war, und wünschte jetzt, er hätte den Kampf zu Ende geführt, solange er dazu Gelegenheit gehabt hatte. Mit geballter Faust wirbelte er herum.
Aber hinter ihm stand nicht der Mann, den er erwartet hatte.